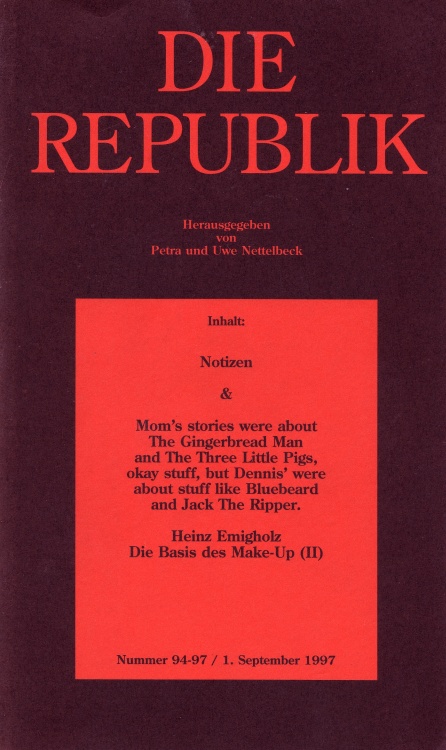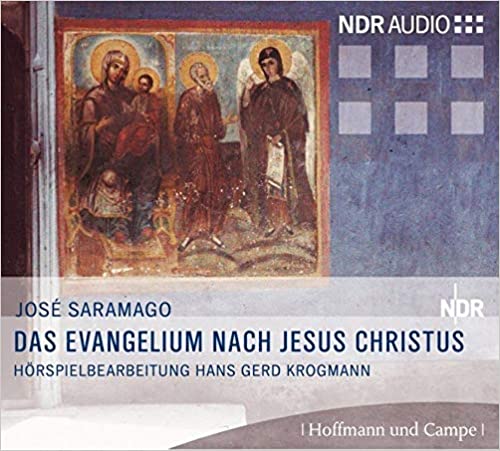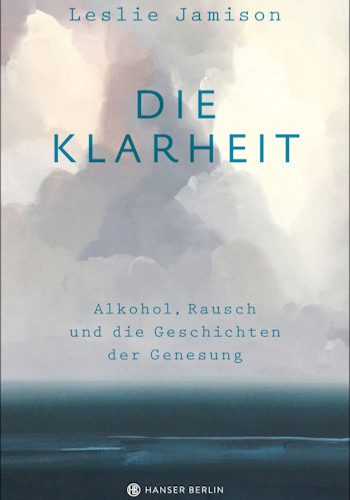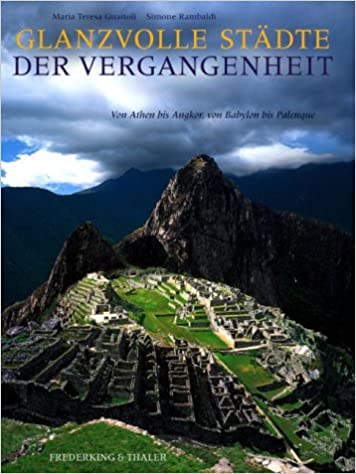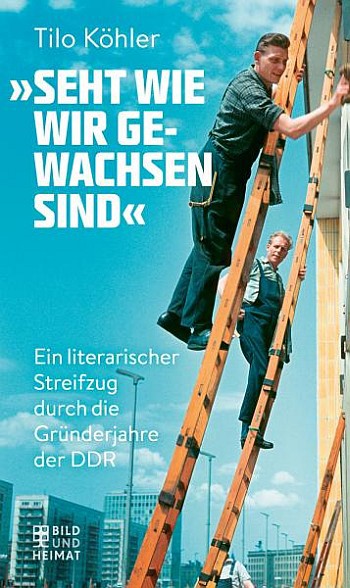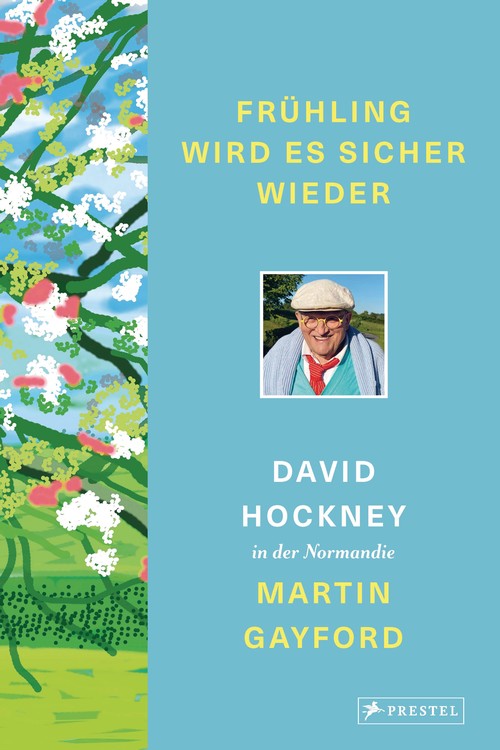Weniger die Schule als die Familie, vor allem der Vater bestimmte im 19. Jahrhundert den Lesekanon. Dabei spielten Verbote ebenso eine Rolle wie Empfehlungen oder das bloße Vorhandensein bestimmter Bücher im Elternhaus. Von THOMAS ROTHSCHILD
 Die öffentliche Kanondiskussion ist fast immer normativ. Nicht was tatsächlich gelesen wird, interessiert, sondern was nach Ansicht der jeweiligen Kanonverschreiber gelesen werden sollte. Die vorliegende Studie geht demgegenüber deskriptiv vor. Sie untersucht die Autobiographien von 51 Menschen, die zwischen 1800 und 1900 geboren wurden und ihre Lektüre thematisiert haben.
Die öffentliche Kanondiskussion ist fast immer normativ. Nicht was tatsächlich gelesen wird, interessiert, sondern was nach Ansicht der jeweiligen Kanonverschreiber gelesen werden sollte. Die vorliegende Studie geht demgegenüber deskriptiv vor. Sie untersucht die Autobiographien von 51 Menschen, die zwischen 1800 und 1900 geboren wurden und ihre Lektüre thematisiert haben.
Dabei beschränkt sich Korte nicht auf eine Bestandsaufnahme, auf einen Titelkatalog, er beschreibt vielmehr, in welchem Lebenszusammenhang die Literatur von jenen, die ihre Lektüre benannt haben, aufgenommen wurde. So berührt das Buch zugleich das Gebiet der Kanonforschung wie das der Rezeptionssoziologie.
Unter den Stichworten »Initiation und Erweckung« belegt Korte an zahlreichen Beispielen, wie bedeutsam das Lesen für jene war, die später darüber schrieben (was natürlich bedeutet, dass man daraus nicht unbedingt Schlüsse über die Gesamtbevölkerung ziehen kann), und welchen Einfluss es auf deren weitere Entwicklung hatte. Der an Realien orientierte historisch-empirische Ansatz verbietet es dem Autor der Studie, fiktionale Texte auszuwerten, die aber wahrscheinlich kein wesentlich anderes Bild ergeben hätten, zumal ja auch Autobiographien die Wirklichkeit stilisieren.
Weniger die Schule als die Familie, vor allem der Vater bestimmte im 19. Jahrhundert den Lesekanon. Dabei spielten Verbote ebenso eine Rolle wie Empfehlungen oder das bloße Vorhandensein bestimmter Bücher im Elternhaus. Die Klage über den schulischen Deutschunterricht, die in unserer Zeit jedem vertraut ist, hebt bereits im 19. Jahrhundert an.
Bemerkenswert erscheint, dass für die literarische Sozialisation neben dem Buch immer wieder das Theater als wichtig erkannt wird. Heute wäre es wohl das Fernsehen, das diese Rolle eingenommen hat. Selbst Studenten der Literaturwissenschaft kennen viele kanonisierte Werke aus einer Fernsehbearbeitung, ehe sie sie lesen.
Vollends historisch scheint dem heutigen Literaturrezipienten die im 19. Jahrhundert verbreitete Übung des lauten Lesens. Und wer lernt heute noch, wie die Nachkriegsgeneration vor 50 Jahren, ganze Gedichte auswendig? Wer macht sich noch ein Vergnügen daraus, aus Werken der Vergangenheit zu zitieren oder Zitate als solche überhaupt zu erkennen?
Ein Register der genannten Werke wäre nützlich. Und der Rezensent vermisst im Zusammenhang des Themas eins seiner Lieblingsbücher: Aus meinem Leben von Franz Michael Felder.
Titelangaben
Hermann Korte: »Meine Leserei war maßlos«
Literaturkanon und Lebenswelt in Autobiographien seit 1800
Göttingen: Wallstein 2007
164 Seiten, 17 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander