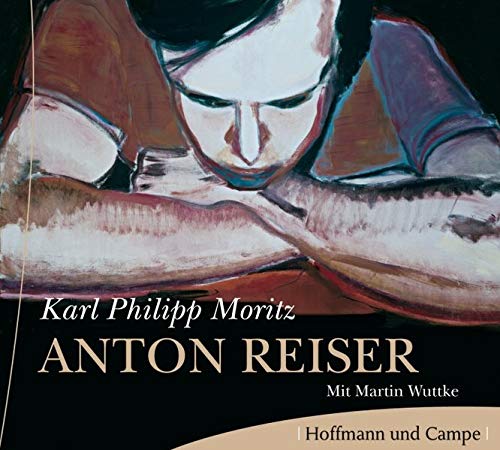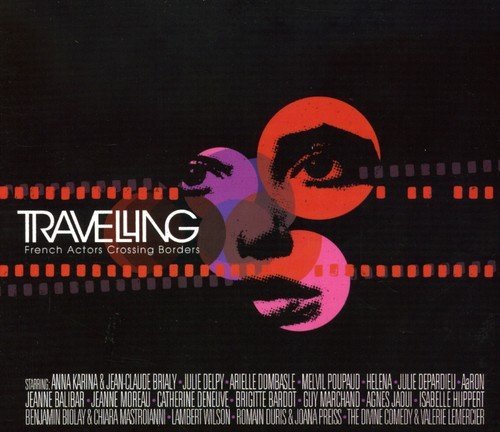In ›Das Mittagsmahl‹ setzt Volker Braun seinen Eltern ein liebevolles Denkmal. Das findet RAINER BARBEY
 Auf dem Jahrmarkt des Literaturbetriebs haben autobiographische Erinnerungsbücher schon seit einiger Zeit beträchtliche Konjunktur, vor allem wenn sie in der Epoche des Nationalsozialismus und/oder der unmittelbaren Nachkriegszeit angesiedelt sind. Dies mag eine der Gründe sein, warum Volker Brauns kleine Erzählung ›Das Mittagsmahl‹, die bereits vor drei Jahren in einem Privatdruck erschien und sich auf den ersten flüchtigen Blick besagtem Genre zuordnen ließe, vom Insel-Verlag nun in einer erweiterten Neuausgabe vorgelegt wird.
Auf dem Jahrmarkt des Literaturbetriebs haben autobiographische Erinnerungsbücher schon seit einiger Zeit beträchtliche Konjunktur, vor allem wenn sie in der Epoche des Nationalsozialismus und/oder der unmittelbaren Nachkriegszeit angesiedelt sind. Dies mag eine der Gründe sein, warum Volker Brauns kleine Erzählung ›Das Mittagsmahl‹, die bereits vor drei Jahren in einem Privatdruck erschien und sich auf den ersten flüchtigen Blick besagtem Genre zuordnen ließe, vom Insel-Verlag nun in einer erweiterten Neuausgabe vorgelegt wird.
Allerdings ist es bestenfalls eine Halbwahrheit, wenn der Werbetext für das bibliophil gestaltete, mit zahlreichen Kupferstichen von Baldwin Zettl illustrierte Bändchen »auf schmalem Raum die Kindheit des Autors« verspricht. Was der 1939 in Dresden geborene Braun in seinen 10 Prosaminiaturen sowie 2 nachgeschalteten Gedichten aus den Jahren 1975 und 1996 beschreibt, ist nicht so sehr die eigene Jugend, sondern vielmehr die Geschichte einer Ehe – die Ehe seiner Eltern, die 1933 im Jahr der Machtergreifung Hitlers geschlossen und 1945 durch den Tod des Vaters in den letzten Tagen des 2. Weltkriegs geschieden wurde, also nahezu exakt zu jener 12 Jahre währenden Schreckensherrschaft des 3. Reiches parallel verläuft.
»Idylle mit geladenem Gewehr«
In dieser Zeit, so wird gleich zu Beginn der Erzählung deutlich, ist das kleine Glück im Privaten, das die frisch Vermählten auf den sächsischen Dörfern suchen, unmöglich. In episodischer Eindruckskunst, in spröde verknappter, oftmals nur andeutender und bisweilen das Lyrische streifender Prosa schildert Braun im Folgenden eine »Idylle mit geladenem Gewehr«, in der »vom Schönsten und vom Schrecklichsten« gleichermaßen die Rede ist, in der sich Liebe und Tod, höchste Lust und barocke Vergänglichkeit beständig mischen.
Bereits in den Jahren des äußeren, freilich schon sehr trügerischen Friedens vor 1939 gleicht die Ehe der Brauns einem harten Kampf um die nackte Existenz. Dem Vater Erich, anfangs fast mittellos, gelingt es erst allmählich, sich ein bescheidenes Auskommen als Vertreter zu sichern und seine Frau sowie eine rasch anwachsende Kinderschar zu ernähren. Während der Alltag der Mutter vollkommen darin aufgeht, »Brei zu kochen, Wäsche zu waschen, Kartoffeln zu schälen, Brühe vom Fleischer zu holen, Dielen zu wischen, Socken zu stopfen«, führt der Vater ein »Doppelleben«, geht jenseits des Brotberufs seinen künstlerischen Interessen nach und läuft auf seiner schwärmerischen Suche nach Schönheit wohl auch anderen Frauen hinterher.
Dennoch lässt der Text keinen Zweifel daran, dass die Beziehung der beiden Eheleute in jenen Jahren der Not auch ein »herrliches Leben« genannt zu werden verdient. Nach Ausbruch des Krieges ist es dann paradoxerweise gerade das über dem Reservisten Erich schwebende Damoklesschwert des Todes, das die raren Momente erfüllter Zärtlichkeit zwischen den Liebenden noch intensiviert – und die Schilderung dieser tragischen Leidenschaft auf Abruf, die ihr augenblickhaftes Glück ausgerechnet in und durch die Zeiten des Krieges gewinnt, gehört sicherlich zu den anrührendsten Passagen des kleinen Buches.
Viele Jahrzehnte später, kurz vor ihrem Tod, erscheint der verwitweten Mutter der im Volkssturm umgekommene Erich noch einmal im Traum. Die Zurückgebliebene erinnert sich ihres »glücklichen furchtbaren Lebens« und grübelt über dem rätselhaften Widerspruch, der den irritierenden Reiz und fast so etwas wie die poetologische Summe von Brauns Text ausmacht: »Daß ihre schönste Zeit eine dunkle gewesen war, FAMILIEFASCHISMUS. Was war die Wahrheit? Die sie nicht zusammendenken konnte. Kann man sie erinnern? Was soll man im Gedächtnis bewahren?«
Einfühlsames literarisches Denkmal
Autobiographsches Schreiben birgt seine Tücken, vor allem für den Leser. Welchen Anteil, so die fast zwangsläufige Frage des Rezipienten, hat die Fiktion, die poetische Stilisierung an den dargestellten Erlebnissen? Wie ist es um die Wahrhaftigkeit dessen bestellt, der da aus seiner persönlichen Erinnerung rekonstruriert und selektiert? »Ich darf nichts erfinden«, ermahnt sich dann auch der Autor der vorliegenden Lebensbeschreibung einmal, wohl wissend, dass er in so mancher Szene seines Berichts auf die Ergänzungen seiner einfühlenden Imagination angewiesen ist.
Auch wird mit ästhetisierenden Kunstgriffen nicht gespart: der Tod des Vaters in der Nähe des Teutoburger Waldes wird mit den Gefallenen der Hermannsschlacht 9 n. Chr., die Luftangriffe des 2. Weltkriegs von einer nachträglich redigierenden Erzählerinstanz mit aktuellen Konflikten (dem jüngsten Golfkrieg) kurzgeschlossen. Doch die säuberliche Trennung von Dichtung und Wahrheit kann man an dieser Stelle getrost den künftigen Biographen überlassen.
Mit ›Das Mittagsmahl‹ ist Volker Braun vielleicht nicht unbedingt ein Stück Weltliteratur, aber ein eindringliches und einfühlsames literarisches Denkmal seiner Eltern in Form einer schönen kleinen Erzählung gelungen.
| RAINER BARBEY
Titelangaben
Volker Braun: Mittagsmahl
Illustriert von Baldwin Zettl
Leipzig: Insel Verlag 2007
65 Seiten, 11,80 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander