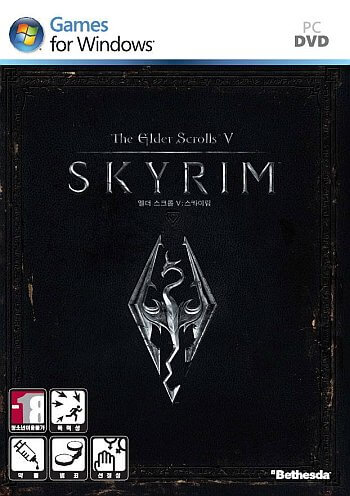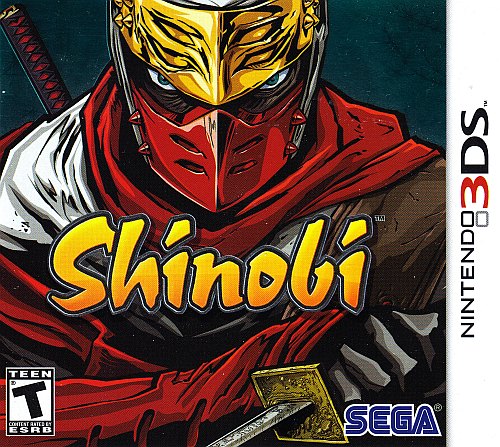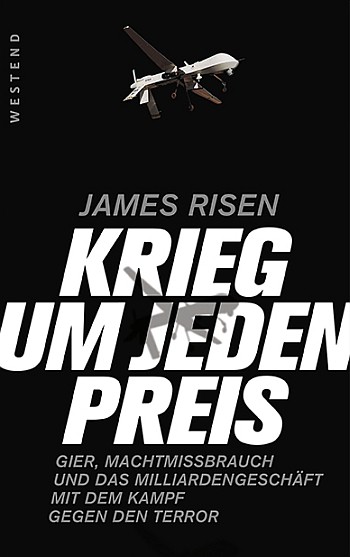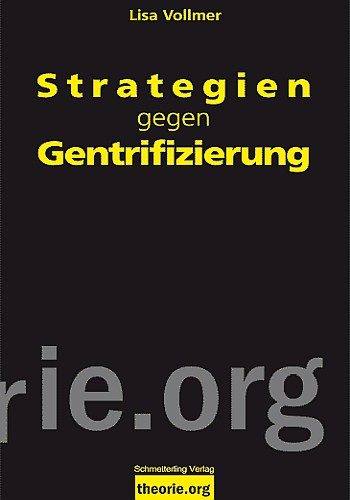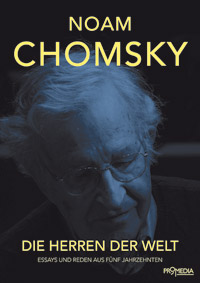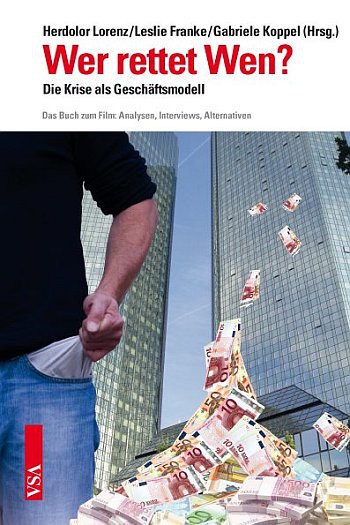Menschen | Hans Neuenfels: Das Bastardbuch
Künstler sind immer besonders, aber Hans Neuenfels ist – ohne Zweifel – besonders besonders. Als Schauspiel- und Opernregisseur polarisierte der heute Siebzigjährige Publikum und Fachwelt. Indem er seinen Lebenserinnerungen den Titel Bastardbuch gab, verlieh er sich das Prädikat eines Nichtangepassten, eines Unzugehörigen, gar eines Ungehörigen, gleich selbst. Sicher ist auch ein wenig Theaterpose dabei. Doch hinter der Selbststilisierung steckt der unerbittliche Ernst einer beispiellosen Kunstbesessenheit. Eine (existentialistische) Haltung, die das Leben prägt. Ein »gefährliches« Leben jedenfalls, nach der Formel Nietzsches. Da kann der Anschein bürgerlicher Geordnetheit täuschen. Von HANS-KLAUS JUNGHEINRICH
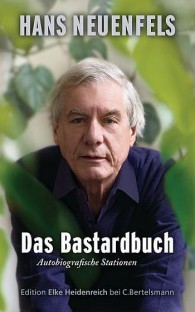 Das »Bastard«-Gefühl zieht als Leitmotiv durchs ganze Buch und scheint manchmal ein wenig überstrapaziert. Immerhin kann hier einer, der in Opposition zu Familie und Gesellschaft steht, auf eine fünfzig Jahre andauernde Beziehung zur Lebens- und Arbeitspartnerin Elisabeth Trissenaar zurückblicken. Praxis dementiert Theorie. Die Erfolgsfamilie Neuenfels lebt nicht in franziskanischer Armut, aber eine ausgebildete Liebe zum Geld wird man ihr nicht nachsagen können. Geld ist ausreichend da und macht deshalb keine Sorgen. Andere haben mehr als genug Geld und sorgen sich dennoch unentwegt drum. Die prekärste Neuenfels’sche Gratwanderung betrifft den Alkohol. Er war für den »Bastard« immer unentbehrliches Produktionsmittel, aber oft auch eine teuflische Gefahr. Genau und ehrlich wird dieses verfluchte, dieses mit Flüchen gesegnete Dilemma im Buch analysiert. Hans Neuenfels, ein Meister der Beobachtung und der Selbstbeobachtung.
Das »Bastard«-Gefühl zieht als Leitmotiv durchs ganze Buch und scheint manchmal ein wenig überstrapaziert. Immerhin kann hier einer, der in Opposition zu Familie und Gesellschaft steht, auf eine fünfzig Jahre andauernde Beziehung zur Lebens- und Arbeitspartnerin Elisabeth Trissenaar zurückblicken. Praxis dementiert Theorie. Die Erfolgsfamilie Neuenfels lebt nicht in franziskanischer Armut, aber eine ausgebildete Liebe zum Geld wird man ihr nicht nachsagen können. Geld ist ausreichend da und macht deshalb keine Sorgen. Andere haben mehr als genug Geld und sorgen sich dennoch unentwegt drum. Die prekärste Neuenfels’sche Gratwanderung betrifft den Alkohol. Er war für den »Bastard« immer unentbehrliches Produktionsmittel, aber oft auch eine teuflische Gefahr. Genau und ehrlich wird dieses verfluchte, dieses mit Flüchen gesegnete Dilemma im Buch analysiert. Hans Neuenfels, ein Meister der Beobachtung und der Selbstbeobachtung.
Vieles wird in wunderbarer Sprachkunst zum Funkeln gebracht. Da spürt man die Wortmacht, die den jungen Neuenfels einst in die Laufbahn eines Lyrikers drängte (mit Veröffentlichungen in der Eremitenpresse und beim Limesverlag). Als jugendlicher Sekretär von Max Ernst wurde er für alle Zeit mit den Wassern des Surrealismus getauft. Dieser ist noch die faszinierende Essenz der (im Bastardbuch integrierten) Laudatio für den mit dem Adornopreis bedachten Dirigenten Michael Gielen in der Frankfurter Paulskirche 1986. Mit Gielen realisierte Neuenfels in Frankfurt legendäre Operninszenierungen, darunter Aida. Auch für andere nahestehende Künstler findet Neuenfels lebhafte Erinnerungsfarben: für Peter Palitzsch und Rainer Werner Fassbinder, für Heiner Müller und Klaus Maria Brandauer, für die Dramaturgen Horst Laube und Klaus Zehelein. Natürlich gibt es auch ein paar Lieblingsfeinde, die nicht ungeschoren wegkommen. Vor allem die im übrigen durchschnittlich clevere Intendantin Kirsten Harms und ihre erbärmliche Entscheidung, in vorauseilender Panik vor einer als militant vermuteten Religionsgemeinschaft die Neuenfels-Inszenierung Idomeneo an der Deutschen Oper Berlin zu verhunzen und zu eliminieren. Das war einer der spektakulären unter den vielen jüngeren Berliner Kulturskandalen.
Mit Selbstkritik spart Neuenfels ebenfalls nicht. Auffällig aber, dass sie ihm bei Schauspielinszenierungen leichter fällt als bei seinen Opernarbeiten. Dort merkt er, wenn eine Annäherung nicht tragfähig, eine Aufführung halb und halb danebengegangen ist; hier scheint er mitunter die Übersicht zu verlieren und hadert auch im Nachhinein mehr mit den Kritikern als mit sich selbst (wie bei der ziemlich unausgegorenen Fledermaus in Salzburg 2001). Bereits in der Theaterprovinz gelangen dem jungen Neuenfels berühmt gewordene Schauspielinszenierungen, etwa die Heidelberger Großtaten Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats (1968) und Zicke Zacke (1969). Als Mitglied des Frankfurter Mitbestimmungsmodells inszenierte Neuenfels 1973 die Ibsenstücke Nora und Hedda Gabler sowie 1974 Brechts Baal. Im selben Jahr war sein Debut als Opernregisseur mit Troubadour in Nürnberg. Nach Verdi »entdeckte« Neuenfels Mozart und Wagner für sich, daneben aber auch Diverses aus dem zeitgenössischen Musiktheater. Über seine beiden Opernlibretti für Adriana Hölszky (Giuseppe e Sylvia, eher misslungen) und Moritz Eggert (Die Schnecke, eher gelungen) äußert er sich im Bastardbuch nicht weiter. Viel und eindringlich beschäftigte sich Neuenfels mit Kleist (Familie Schroffenstein, Penthesilea als Schauspiel und als Oper von Othmar Schoeck).
Beim Nachdenken über Inszenierungen greift Neuenfels gelegentlich auch mal zum etwas abgegriffen anmutenden Dramaturgenjargon. Ganz frisch und neu erfunden wirken aber die Gedanken, die abschließend (bei der etwas kursorischen Erinnerung an sieben selbst gedrehte Filme) über Film und Kino formuliert werden. Angenehm, dass Neuenfels, dem Psychologisieren sonst keineswegs abhold, die Hintergründe und Unterströme seiner ehelichen Beziehung verschweigt. Klatsch und Tratsch, dieses sonst reichlich in die Theatersuppe gekippte Salz, sind bei Neuenfels rar. Dafür werden umwerfend-anrührende Geschichten erzählt, etwa die der närrischen Schwiegermutter, die für ihre geplante Flucht aus der Anstalt vierzig Bananen im Handtascherl bunkert, oder die vom langen Sterben des Hundes Eugen, hochkomisch und tieftraurig zugleich, mit Hans Neuenfels in der nun wirklich rekordverdächtigen Rolle des »unauffälligsten Hundekotentferners des deutschen Theaters«.
Wer Neuenfels’ Bastardbuch gelesen hat, reibt sich erstaunt die Augen über die intellektuelle Kraft (als wäre Gefahr ein besseres Regenerationsmittel als Gesundheit) dieser Vergegenwärtigung von fast 50 Jahren deutscher Theatergeschichte. Neuenfels war dabei (vier Jahre sogar als Intendant der »Freien Volksbühne« in Berlin) und doch nicht dabei. Niemals vom Typus eines institutionellen »Machthabers«. Keiner, auf den sich das Establishment verlassen konnte. Vielleicht doch ein »Bastard«. Auf jeden Fall ein besonderer Künstler.
| HANS-KLAUS JUNGHEINRICH
Titelangaben
Hans Neuenfels: Das Bastardbuch. Autobiographische Stationen
München: Edition Elke Heidenreich bei C. Bertelsmann 2011
512 Seiten, 19,95 Euro