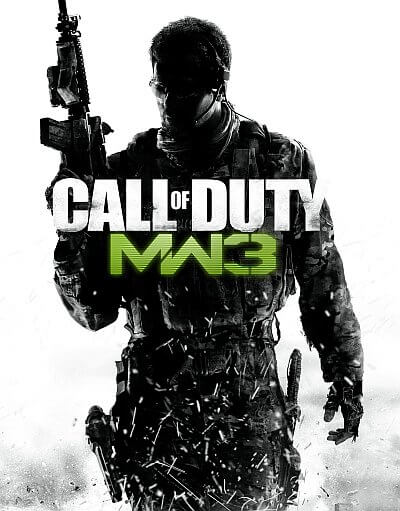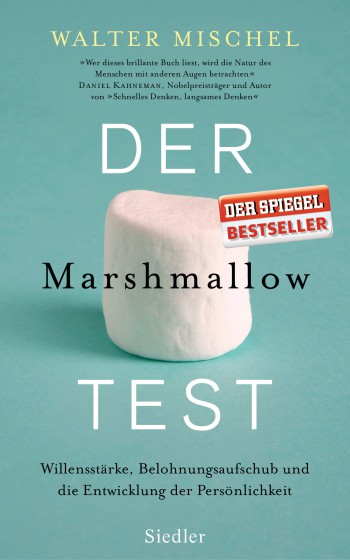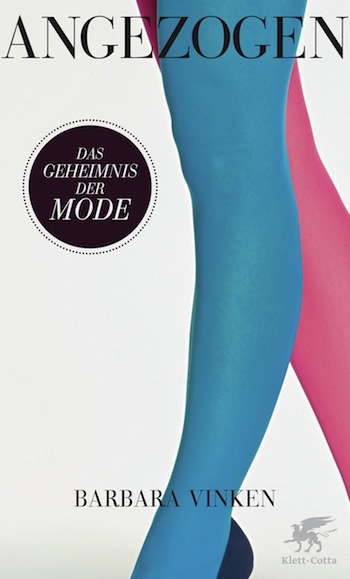Kulturbuch | Andreas Tönnesmann: Monopoly
Zeig mir, was du spielst, und ich sag dir, was aus dir wird! Wer sein Adrenalin mit Ego-Shooter-Games auf- und abhetzt, kann im Grunde nur Amokläufer werden. Genau wie prädigitale Generationen im nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet bekanntlich durchweg miese Kapitalistenschweine wurden, weil sie mit Feuereifer Monopoly gespielt hatten. Wie albern solche Kurzschlüsse sind und was sich stattdessen an Kulturell-Politisch-Gesellschaftlichem mit Monopolyverknüpfen lässt, zeigt Andreas Tönnesmanns in Monopoly. Das Spiel, die Stadt und das Glück. Von PIEKE BIERMANN
 Für Hasbro-Aktien sieht es seit diesem Frühsommer gar nicht gut aus. Ist das womöglich ein vorausgeworfener Schatten der neuen Spielart antikapitalistischer Bewegtheit namens Occupy Wall Street, obwohl die erst ab Herbst virulent wurde? Nach der joyceanischen Dialektik des Züricher Schrift-Gelehrten Fritz Senn, der schon 1982 beim Dubliner Gedenkmarathon zum 100. Geburtstag Joyces Einfluss auf Homer (und umgekehrt) untersucht hatte, darf man darüber mit Fug spekulieren.
Für Hasbro-Aktien sieht es seit diesem Frühsommer gar nicht gut aus. Ist das womöglich ein vorausgeworfener Schatten der neuen Spielart antikapitalistischer Bewegtheit namens Occupy Wall Street, obwohl die erst ab Herbst virulent wurde? Nach der joyceanischen Dialektik des Züricher Schrift-Gelehrten Fritz Senn, der schon 1982 beim Dubliner Gedenkmarathon zum 100. Geburtstag Joyces Einfluss auf Homer (und umgekehrt) untersucht hatte, darf man darüber mit Fug spekulieren.
Man kann aber auch, wenn man, wie der Zürcher Kunst- und Architekturhistoriker Andreas Tönnesmann, Spaß am Aufspüren geheimer Verbindungslinien zwischen scheinbar Entlegenem hat, die These wagen, der Kurssturz verdanke sich der jäh erloschenen Nachfrage nach dem profitabelsten Produkt der Spielzeugfirma der Gebr. Hassenfeld aus Rhode Island: Hasbro vertreibt Monopoly. Bislang wurden 275 Millionen Stück in 43 Länderausgaben weltweit verkauft. Wer will denn in Zeiten der globalen Schuldenkrise noch Immobilienhai im Raubtierkapitalismus spielen?
Die jüngste Weltwirtschafts- und Bankenkrise kommt bei Tönnesmann noch nicht vor, wohl aber die älteste, der Börsencrash von 1929. Denn Tönnesmann erzählt einerseits die Geschichte des Monopoly-Spiels detailreich noch einmal nach. Ursprünglich erfunden hatte es 1904 die Quäkerin und Stenographin Mary Magie Philips als Landlord’s Game, ein Spiel, bei dem es um den Erwerb von Grundbesitz ging. In den Jahrzehnten danach wurde es von verschiedenen Leuten unter verschiedenen Namen weiter entwickelt. Eine Boom-Story wurde erst ab 1936 daraus. Da hatte sich der Klempner Charles B. Darrow aus Germantown, Pennsylvania, bei allen Ideengebern bedient und aus sämtlichen Plagiaten ein so massenkompatibles Spiel gebastelt, dass ihm Parker Bros, Hasbros’ Vorläufer, die Rechte abkaufte. Darrow erhielt eine Gewinnbeteiligung, die ihn überlebenslänglich reich machte. Für Tönnesmann überstrahlt Darrows innovative marktkonforme Modernisierung locker den schlechten Geschmack des Ideenklaus – auch eine Art Dialektik.
Utopie der idealen Stadt
Er hatte eine fiktive Stadt mit den Straßennamen von Atlantic City entworfen. Auf den Straßen dürfen die Spieler privaten Grundbesitz erwerben, sie dürfen Häuser und Hotels darauf errichten und mit ihnen sowie mit (Würfel-) Glück private Einnahmen generieren. Darrow hatte aber außerdem vier Bahnhöfe, ein Wasser- und ein Elektrizitätswerk dazu gesetzt. Also Einrichtungen der öffentlichen Hand, wie es bei uns heißt. Mit dieser originär Darrowschen Idee verknüpft Tönnesmann zum Beispiel spannende Überlegungen zu den Wechselwirkungen zwischen Spielen und Politik. Für ihn ist sie ein Kommentar zum historischen Kontext: Seit 1933 pumpte Franklin D. Roosevelts New Deal staatliches Geld unter anderem in die Förderung der Infrastruktur. Es war eine Maßnahme gegen die Große Depression, wirkungsvoll und gleichzeitig heftig umstritten. Government money als Jobmaschine – im Land der reinen Lehre von freiem Markt und Privatwirtschaft ist sowas mindestens ein Tabubruch, wenn nicht gar purer Kommunismus. Und was macht Darrow? Er reprivatisiert die öffentliche Hand, gibt spielerisch Verkehrsbetriebe und Energieversorgung wieder frei für Privatbesitz.
Andererseits vertieft Tönnesmann den Blick in die – vor allem europäische – Stadtgeschichte. Er legt die Monopoly-Topographie über alte und jüngere utopische Modelle einer »idealen Stadt«. Mit Exkursionen in Entwürfe von der Renaissance bis in die Moderne, von Filarete, Dürer, Morus, Loos bis Frank Lloyd Wright, und in Spieltheorien von Kant und Huizinga, präpariert er Parallelen ebenso heraus wie Auseinanderstrebendes. Idealstädte, so seine Leitlinie, sind immer Konzeptionen des Glücks. Sein Fazit: Monopoly ist eine moderne Utopie der idealen Stadt.
Aus dem ideologischen Käfig befreit
Das liest sich wunderbar leicht und mit viel Erkenntnisgewinn. Aber – und an dieser Stelle darf die Rezensentin in Ich-Form sprechen, weil’s auch der Autor bei seinem Einstieg tut – als Stadt habe ich Stadtkind Monopoly nie empfunden. Mir fehlten Konsum, Kliniken, Kirchen, Kinos, Friedhöfe, Verkehr aller Art. Ideal war natürlich, dass man nicht arbeiten musste und trotzdem immer Geld bekam, zinsfrei obendrein, von einer Bank, die eher wie ein altruistischer Papa Staat auftritt. Aber meinSpaß am Spiel war ganz un-utopisch, er war einfach diebisch: Ich habe immer zugesehen, dass ich die Bank verwalte, und mich frei nach Brecht bedient. (Eine reale Karriere etwa als Boss der HypoRealEstate hätte ich trotzdem kaum ins Auge gefasst.)
Dem Spaß am Buch tut all das natürlich keinen Abbruch. Der hat andere Gründe, zum Beispiel diesen: Tönnesmann hat Monopoly aus dem engen ideologischen Käfig, in den es im Kalten Krieg geraten war – die Älteren erinnern sich noch an diverse stramm antikapitalistische Monopoly-Versionen samt »Die Monopole zerschlagen! Die Arbeiterklasse befreien!«-Slogans – endlich (gedanken-) spielend befreit.
Eine erste Version dieser Rezension wurde am 6. Dezember 2011 bei Deutschlandradio Kultur veröffentlicht.
Titelangaben
Andreas Tönnesmann: Monopoly
Das Spiel, die Stadt und das Glück
Berlin: Wagenbach 2011
142 Seiten. 22,90 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander