Sachbuch | Christina Stiegler: Die Bombe unter dem Tisch
Bekanntlich unterscheidet man im Englischen zwischen »mystery« und »suspense«. Und bekanntlich hat Alfred Hitchcock stets für sich beansprucht, dass er an Suspense und nicht an Mystery interessiert sei – obwohl man in seinen Filmen durchaus auch Beispiele für Mystery entdecken kann. Das Problem ist, dass sich Suspense nur sehr schwer definieren lässt, was die Voraussetzung für die Abgrenzung gegen andere Kategorien und Begriffe wäre. Von THOMAS ROTHSCHILD
 Hitchcock selbst hat, wenn er Suspense erklären wollte, gern auf Beispiele zurückgegriffen. Aber Beispiele liefern noch keine Definition. Wenn man den Begriff des Suspense zu weit fasst, besteht die Gefahr, dass er auch Phänomene einschließt, die man eigentlich nicht berücksichtigen wollte; fasst man ihn zu eng, deckt er nicht alles ab, was man der Intuition nach dem Suspense zuordnen würde. Was also sind die notwendigen und hinreichenden Bedingungen, die unverzichtbaren und vollständigen Eigenschaften des Suspense, und wie wird er hergestellt, spezifischer: wie stellt Hitchcock, der unangefochtene Meister des Suspense, ihn her?
Hitchcock selbst hat, wenn er Suspense erklären wollte, gern auf Beispiele zurückgegriffen. Aber Beispiele liefern noch keine Definition. Wenn man den Begriff des Suspense zu weit fasst, besteht die Gefahr, dass er auch Phänomene einschließt, die man eigentlich nicht berücksichtigen wollte; fasst man ihn zu eng, deckt er nicht alles ab, was man der Intuition nach dem Suspense zuordnen würde. Was also sind die notwendigen und hinreichenden Bedingungen, die unverzichtbaren und vollständigen Eigenschaften des Suspense, und wie wird er hergestellt, spezifischer: wie stellt Hitchcock, der unangefochtene Meister des Suspense, ihn her?
Dieser Frage geht die umfangreiche Dissertation von Christina Stiegler nach. Dabei kann sie auf eine Unmenge von Vorarbeiten aufbauen. Über kaum einen Filmregisseur wurde mehr geschrieben als über Hitchcock. Und doch: eine systematische Erklärung des Suspense in seinem Werk stand aus den genannten Gründen aus. Die meisten Autoren schwindeln sich um sie herum.
Der Titel der vorliegenden Arbeit sagt mit erfreulicher Deutlichkeit, worum es geht: Die Bombe unter dem Tisch. Suspense bei Alfred Hitchcock – oder: Wie viel weiß das Publikum wirklich? Der Alternativtitel nimmt die gängige These auf, dass Suspense zur Bedingung habe, dass der Zuschauer mehr weiß als die Akteure auf der Leinwand, und stellt sie zugleich infrage.
Christina Stiegler geht von dem Gespräch aus, das François Truffaut mit Alfred Hitchcock geführt hat und das längst zu den Klassikern der Filmliteratur zählt. Hier liegt ja der seltene Fall vor, dass einer, der nicht nur als Kritiker und Theoretiker beschlagen, sondern als Filmemacher ausgewiesen ist, ausführlich und kenntnisreich auf Augenhöhe mit seinem Gesprächspartner die wesentlichen Punkte anspricht. Damit lassen sich allenfalls einige Interviews von Peter Bogdanovich und von Alexander Kluge vergleichen. Im weiteren Verlauf hinterfragt Stiegler Hitchcocks Selbstaussagen, nicht zuletzt auf die Umsetzung in seinen Filmen hin. Sie weist Widersprüche und Ungenauigkeiten nach. Sie untersucht die Rezeption von Hitchcocks Ausführungen zum Suspense-Begriff und bemüht sich um seine Abgrenzung gegenüber »Spannung«, »Tension« und »Thrill«.
Für jeden Filmliebhaber von Interesse
Stieglers »Kernthese« besagt, »dass Hitchcock in seinen Filmen – anstelle dem Publikum ein Vorwissen zu vermitteln, über das der/die Protagonist(en) keine Kenntnis besitzt/besitzen – überwiegend einen Wissensgleichstand zwischen Zuschauer und Hauptfigur hergestellt hat«. Diese These wird an fünf Filmen überprüft in einem Kapitel, das für sich so umfangreich ist wie die vier vorausgegangenen Kapitel zusammengenommen. Dass Stiegler am Ende jeder Analyse die Kategorien »Suspense«, »Similarity«, »unspezifische Vorahnung« und »Surprise-Phase« jeweils bis in die Sekunde hinein tabellarisch protokolliert, dürfte einem dogmatischen Verständnis (des Doktorvaters?) von der wissenschaftlichen Bedeutung quantifizierbarer Ergebnisse zu verdanken sein. Die entscheidenden Aussagen wurden im beschreibenden Teil gemacht, die Pseudogenauigkeit von Zahlen fügt ihnen nichts Wesentliches hinzu.
In dem abschließenden Kapitel über inhaltliche und formale Gestaltungsverfahren bei Hitchcock nennt die Autorin eine Fülle von teils vertrauten, teils wenig beachteten Charakteristika, die jedes für sich eine eigene Arbeit rechtfertigten. Ein Desiderat wäre es, den Zusammenhang von Suspense und einem anderen, sehr viel seltener im Zusammenhang mit Hitchcock erwähnten Merkmal seiner Filme zu untersuchen: mit dem Humor. Was Suspense und Witz verbindet, ist »Surprise«, die Überraschung – aber wie verhält sich Hitchcocks sehr englischer, sehr intellektueller Witz zu den Erfordernissen des Suspense oder auch zur Kategorie der »Angst«, die Hitchcock selbst im Kontext von Suspense nennt? Da Christina Stiegler sich ausdrücklich auf Hitchcock beschränkt, bleibt eine weitere Frage offen, die doch nach einer Antwort verlangt: Wie tauglich ist der (von Christina Stiegler so minutiös herausgearbeitete) Suspense-Begriff für andere Filmemacher, für Fritz Lang etwa oder für Jean-Pierre Melville oder für Martin Scorsese? Ist er über Hitchcock hinaus verwendbar, und wenn nicht – wie soll man ähnliche Phänomene bei anderen Regisseuren nennen? Ist er, darüber hinaus, für Spezifika der Kameraarbeit, der Lichtführung, der Musik etc. (Stiegler streift sie auf knapp 20 Seiten am Ende ihrer Arbeit) gleichermaßen funktional wie für dramaturgische Verfahren?
Dissertationen dienen dem Erwerb eines akademischen Grads und sind in der Regel unlesbar. Gelegentlich deutet manches darauf hin, dass selbst jene, die sie zu beurteilen hatten, sie nicht gelesen haben. Dieses Buch von Christina Stiegler ist, thematisch wie sprachlich, durchaus für jeden Filmliebhaber von Interesse und, sieht man von der manchmal lästigen Fülle der Fußnoten ab (der Plagiatsverdacht hat auch unangenehme Folgen), frei von Jargon und wissenschaftsüblichen Unsitten.
| THOMAS ROTHSCHILD
Titelangaben
Christina Stiegler: Die Bombe unter dem Tisch. Suspense bei Alfred Hitchcock – oder: Wie viel weiß das Publikum wirklich?
Konstanz: UVK 2011
368 Seiten, 39 Euro



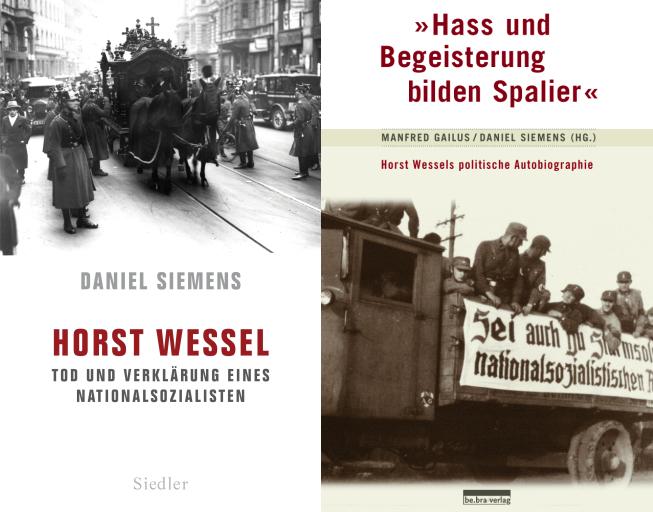




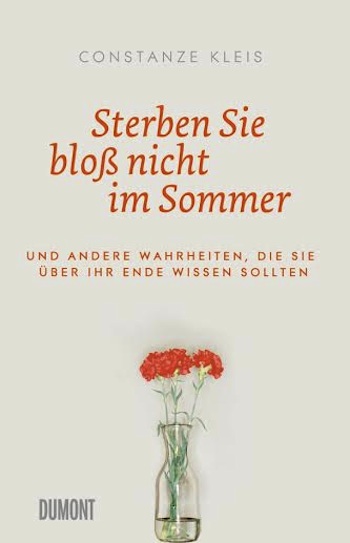
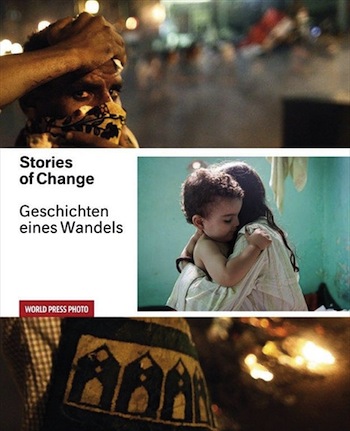

[…] Hitchcock und die Herstellung von Suspense – Thomas Rothschild zu Christina Stiegler: Die Bomb… – im TITEL […]