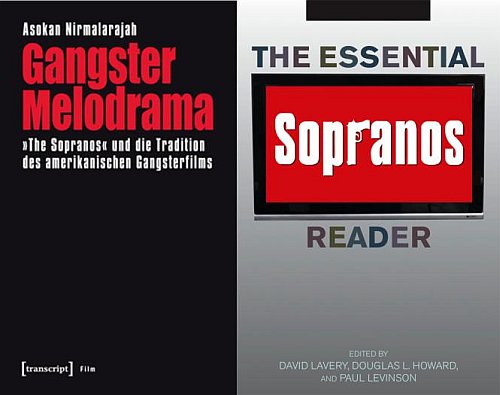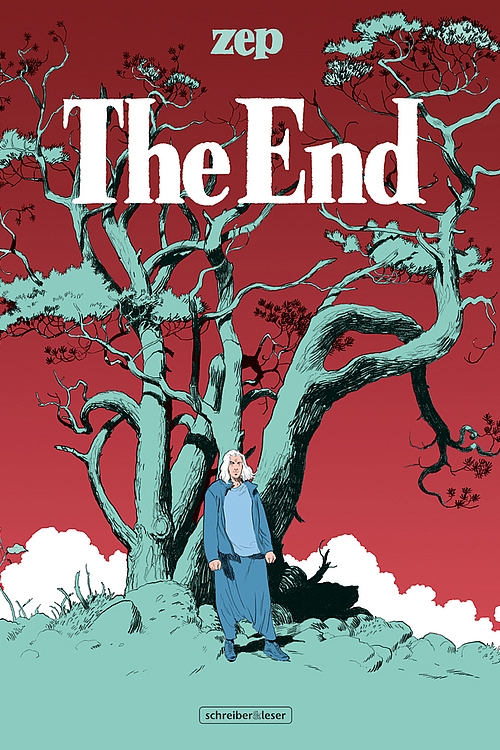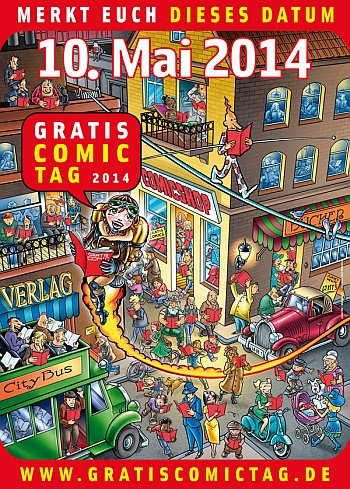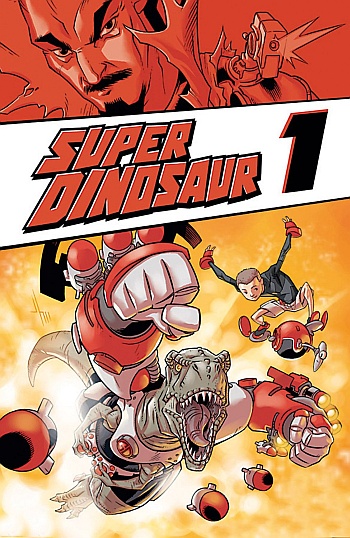Comic | Jodorowsky/Fructus: Showman Killer
Wenn ausgerechnet Incal-Autor Alejandro Jodorowsky, der inzwischen auch »Heilung durch Kunst« betreibt, die Geschichte des mächtigsten Killers des Universums erzählt, will BORIS KUNZ unbedingt dabei sein.
 Aus dem Sperma von Massenmördern geklont, im Leib einer komatösen Mutter herangewachsen, von Maschinen aufgezogen, alle menschlichen Gefühle im Kindesalter operativ entfernt, dafür mit einem Gerät versehen, das es ihm erlaubt, jegliche andere Gestalt (auch die eines Felsmassivs) anzunehmen – das ist der Showman Killer. Dieser unbesiegbare Söldner kennt nur eine Moral: Er tötet allein für den Meistbietenden.
Aus dem Sperma von Massenmördern geklont, im Leib einer komatösen Mutter herangewachsen, von Maschinen aufgezogen, alle menschlichen Gefühle im Kindesalter operativ entfernt, dafür mit einem Gerät versehen, das es ihm erlaubt, jegliche andere Gestalt (auch die eines Felsmassivs) anzunehmen – das ist der Showman Killer. Dieser unbesiegbare Söldner kennt nur eine Moral: Er tötet allein für den Meistbietenden.
Nachdem ein kurzer Prolog uns die Genese dieses eigentümlichen »Helden ohne Herz« beschrieben hat, gerät der Showman-Killer auch schon in ein größeres politisches Komplott, das, wie bei Jodorowsky üblich, von allerhand düsteren Ikonen weltlicher und religiöser Macht bevölkert ist. Die Mönchsoldaten der Suprahierophantin (eine bösartige, schwebende Mumie) wollen den Thronerben des Omnimonarchen (ein erstaunlich menschlich geratener Imperator) vernichten und die Schuld dafür der Rebellengruppe der »Nihilos« in die Schuhe schieben, auf die wiederum der Showman Killer angesetzt worden ist.
Jodorowsky im Zitatekarussel
Wer mit den Werken von Jodorowsky halbwegs vertraut ist, der findet im Showman Killer wenig Neues. Bis hin zu so eigentümlichen Wortschöpfungen wie »Paläohündin« bleibt der Autor seinen Themen ebenso treu wie seinem Erzählton: Die Machtkämpfe voller Superlative, der überhöhte Mystizismus der Bilder, die Jodorowsky heraufbeschwört, werden durch einen leisen Humor ausgeglichen, der immer wieder durchschimmert und uns zeigt, dass diese Geschichte nicht so sehr als ätzende Gesellschaftsparabel gemeint sein könnte, sondern einfach nur dazu da ist, Spaß zu machen.
Ein klein wenig parodiert Jodorowsky dabei auch sich selbst – aber nicht allein sich selbst: Nicht nur die Meta-Barone lassen im Aussehen des glatzköpfigen Showman Killers grüßen, die Entstehungsgeschichte dieses Monsters erinnert auch gewaltig an den Superschurken Doomsday, dem es in einer der spektakulärsten Superheldenepen der Neunziger vergönnt war, Superman zu töten. Die Aquarelltechnik des Illustrators Nicolas Fructus und teilweise auch das Design seiner archaischen Zukunftswelten wecken Assoziationen an El Mercenario oder Storm, und die Attitüde, es immer gleich mit den übelsten, größten und gewaltigsten Herrschern und Schurken zu tun zu haben, dieses elegante Spiel mit der Großkotzigkeit also, hat man auch schon in den Authority-Comics von Warren Ellis zu spüren bekommen.
Welche dieser Anspielungen tatsächlich als solche gemeint sind, ist schwer zu sagen und letztlich auch nicht relevant. Man kann zumindest viele hineinlesen, weil Jodorowsky und Fructus nichts anderes tun, als ein gewaltiges Bildfeuerwerk abzubrennen, das nicht so sehr durch die geniale Komposition einzelner Kaskaden als eher durch seine bunte Gesamtheit gefällt. Die Geschichte ist rasant erzählt und wird von Fructus durchaus imposant illustriert.
Doch auch den Zeichnungen gelingt es immer wieder, die grotesken und humoresken Elemente nicht zu kurz kommen zu lassen – vor allem in den ausschweifenden Metzeleien, die der ultimative Killer unter seinen Gegnern anrichtet. Man kann ja auch nicht die Geschichte einer perfekten Tötungsmaschine erzählen, ohne dabei gehörig Blut zu vergießen.
Alles in allem eine gute Lektüre für Jodorowsky-Fans, die zwar wenig Neues bietet, aber auch nicht langweilt.
Titelangaben
Alejandro Jodorowsky (Text) / Nicolas Fructus (Zeichnungen): Showman Killer Band 1: Ein Held ohne Herz (Showman Killer, Tome 1).
Aus dem Französischen von Uwe Löhmann.
Köln, Ehapa Verlag 2011. 56 Seiten, 13,99 Euro