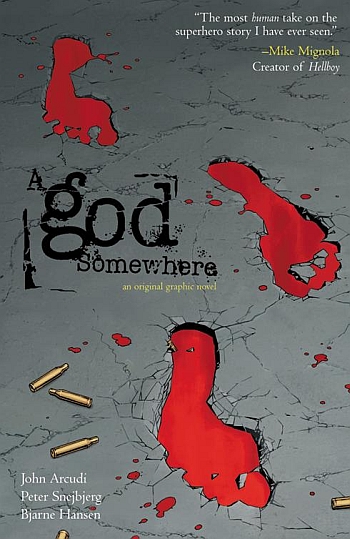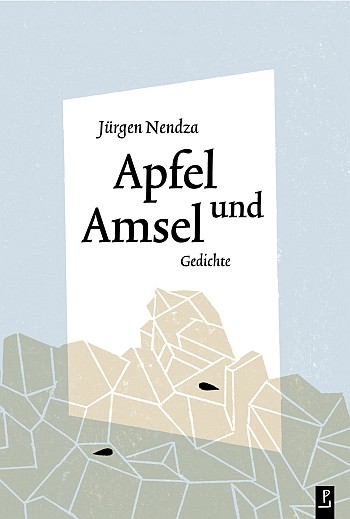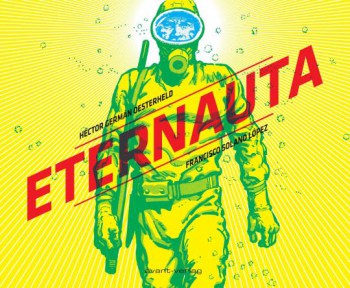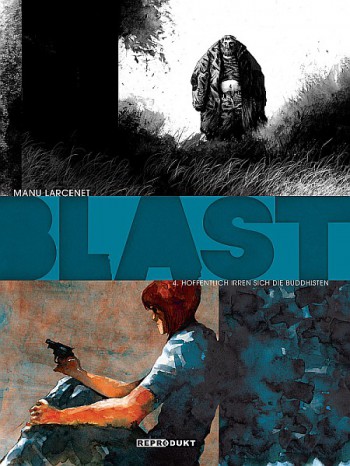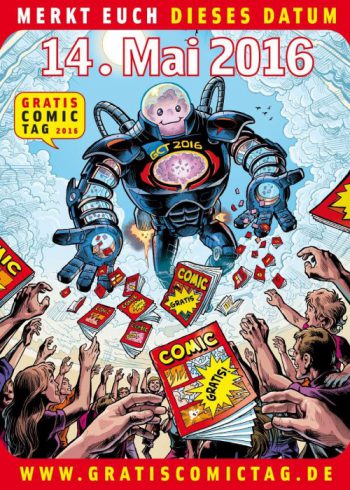Comic | MADs große Meister: Don Martin
13 Jahre nach seinem Tod steht der Zeichner Don Martin noch immer für den Stil des Satiremagazins MAD. Jetzt beginnt die Veröffentlichung aller Comics, die er dort publiziert hat. ANDREAS ALT hat den ersten Band unter die Lupe genommen.
 Das erste MAD-Taschenbuch des Bildschriften Verlags erschien 1974 unter dem Titel ›Don Martin hat Premiere‹. Das ist ein Hinweis darauf, dass dieser Zeichner eine herausragende Position hatte – jedenfalls in den deutschen MAD-Ausgaben. Don Martin hatte einen unverwechselbaren Zeichenstil, der zudem zur Freude mehrerer Schülergenerationen nicht allzu schwer nachzuahmen war. Für viele war er der komischste MAD-Künstler.
Das erste MAD-Taschenbuch des Bildschriften Verlags erschien 1974 unter dem Titel ›Don Martin hat Premiere‹. Das ist ein Hinweis darauf, dass dieser Zeichner eine herausragende Position hatte – jedenfalls in den deutschen MAD-Ausgaben. Don Martin hatte einen unverwechselbaren Zeichenstil, der zudem zur Freude mehrerer Schülergenerationen nicht allzu schwer nachzuahmen war. Für viele war er der komischste MAD-Künstler.
Bei Panini, wo das deutsche MAD aktuell erscheint, ist Don Martin nun auf den zweiten Platz abgerutscht. In der Reihe MADs große Meister musste er dem Marginal-Kritzler Sergio Aragones den Vortritt lassen. Nun aber wird auch er in drei dicken Bänden geehrt. Er ist also auf dem deutschen Comic-Markt offenbar immer noch eine große Nummer.
Zerknitterte Anatomie und umgeknickte Füße
Ihn die Verkörperung dieses innovativen, wegweisenden US-Satireblatts zu nennen, wäre freilich übertrieben. Seinen Ehrentitel ›MADs Maddest Artist‹ kennt man in Deutschland erst seit Kurzem. Es gab dort wichtigere Namen: Harvey Kurtzman, Al Feldstein oder Wally Wood. Don Martin stieß 1956 nach Grafikausbildung und anschließendem Kunststudium zur Mannschaft des Verlegers Bill Gaines. Da war das 1952 gegründete Comic-Heft seit einem Jahr zum Magazin mutiert und damit der Selbstzensur der US-Comicindustrie entgangen. In der Heftserie, die von Zeichnern der berühmten EC-Horrorserien wie Feldstein, Wood oder Jack Davis gestaltet wurde, hätte er mit seinem Funny-Stil womöglich gar nicht Fuß fassen können. Seine bescheuerten Figuren trugen Namen wie Fred Feinbein, hatten eine zerknitterte Anatomie, vor allem umgeknickte Füße, abenteuerliche Frisuren, gerieten in waghalsige Slapstick-Situationen und gaben dabei Geräusche wie »Splitzz« oder »Katchunka« von sich.
Don Martin war Freiberufler. Er saß nie in der New Yorker Redaktion, sondern lieferte seine abgedrehten Beiträge per Post aus Miami. Privat war er ganz und gar nicht verrückt, sondern ein introvertierter, höflich-zurückhaltender und soignierter Mann. MAD-Redakteur Herbert Feuerstein, der ihn mehrmals persönlich traf, erinnerte er an einen »Senator aus Westvirginia«. 1987 gab Martin seine Zurückhaltung auf und kehrte MAD nach einem längeren Streit über seine Urheberrechte den Rücken. Verleger Gaines hatte seine Zeichner und Autoren zwar immer sehr großzügig bezahlt, sich aber alle Verwertungsrechte und den Verkauf der Originalzeichnungen auf eigene Rechnung vorbehalten. Martin ging zur Konkurrenz, dem Magazin Cracked, laut Feuerstein ging es aber von da an körperlich mit ihm bergab. Er starb Anfang 2000 mit 68 Jahren an Krebs.
Anfänge als Illustrator und Plattencover-Künstler
Sehr viel mehr ist über Martin nicht bekannt. Und das ändert sich auch durch den ersten der drei Panini-Bände nicht. In das Buch sind ein paar Statements befreundeter Comic-Künstler eingestreut. Hella von Sinnen steuert das Vorwort bei, stützt sich darin aber hauptsächlich auf Feuerstein. Peter Bagge weist als Einziger darauf hin, dass Martin anfangs auch als Illustrator und Plattencover-Künstler gearbeitet hat. Also muss das Werk über ihn Auskunft geben. Der erste Band versammelt seine Veröffentlichungen zwischen September 1956 und Juli 1967.
Einen spektakulären Start hatte der MAD-Meister nicht eben. Er parodierte Ratgeber-Rubriken und TV-Werbespots, was zumindest aus heutiger Sicht nur mäßig komisch ist. Bemerkenswert aber: Seine markante Handschrift ist im Wesentlichen von Anfang an da, sein Stil wird nur über die Jahre einfacher und klarer. Und schon einige seiner frühesten Comics zeigen sein Talent, recht simple Gags präzise zu inszenieren und damit absurden Witz zu erzeugen – wie das Laurel und Hardy im Film konnten. Später hat sich Martin häufig Ideen von Don »Duck« Edwing liefern lassen. Seine Stärke war sicher nicht das Erfinden witziger Geschichten.
Die unmerkliche Verwandlung des »Dr. Jekyll«
Ein typischer Comiczeichner ist Don Martin anfangs nicht gewesen. Relativ selten verwendet er Sprechblasen. Meist verzichtet er auf feste Panels. Das deutet eher auf einen Cartoonisten hin, der sich in die Comicbranche verirrt hat. Das erste Soundwort im Buch ist »Uuuuurp!«, das Rülpsen einer fleischfressenden Pflanze. Erstmals zur Perfektion gereift ist sein Zeichenstil meiner Ansicht nach 1963 in Dr. Jekyll und Mr. Hyde, einem Comic, dessen Pointe über zwei Seiten hinweg meisterhaft verzögert wird. Interessant wäre, wie er zu den Comics und zu MAD kam – vielleicht ist darüber ja mehr in Band 2 oder 3 zu erfahren.
Ein erster herausragender Beitrag ist für mich Das Schachspiel von 1958, wo die beiden Spieler in neun Bildern ihre Haltung nur minimal verändern und dennoch ein erschreckendes Drama abläuft. Ab 1959 wird Martin zunehmend kühner: Menschen verwandeln sich in Geldautomaten oder Brummkreisel, werden zu einem Haufen Gummi zusammengeknetet oder beim Sturz durch eine Harfe in Scheiben geschnibbelt. Am Ende wird sogar der Kopf eines Friseurkunden geteert und flach gewalzt.
Der klassische MAD-Leser vermisst die »Abt.«-Rubrizierung, offenbar eine Spezialität des deutschen MAD bis 1994. Die kurzen Einleitungstexte zu vielen der Comics haben nicht besonders viel Esprit – sie mögen richtig übersetzt sein, aber Herbert Feuerstein hat damals daraus viel mehr gemacht. Trotz kleinerer Abstriche: Es ist faszinierend, die Kunst des Don Martin in dieser geballten Form zu studieren. Und für einige Stunden bester Unterhaltung taugt der Wälzer allemal. Panini will das Don-Martin-Gesamtwerk bis 2014 komplett vorlegen.
| ANDREAS ALT
Titelangaben
MADs große Meister: Don Martin. Die MAD-Werke der Zeichner-Legende.
Band 1: 1956 – 1967. Aus dem Amerikanischen von Oliver Naatz und Mathias Ulinski.
Stuttgart: Panini Comics 2012.
340 Seiten, 49,90 Euro.