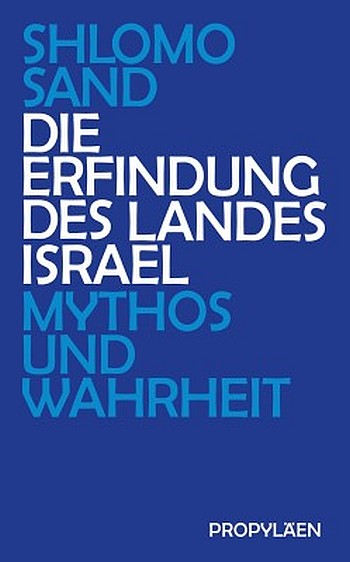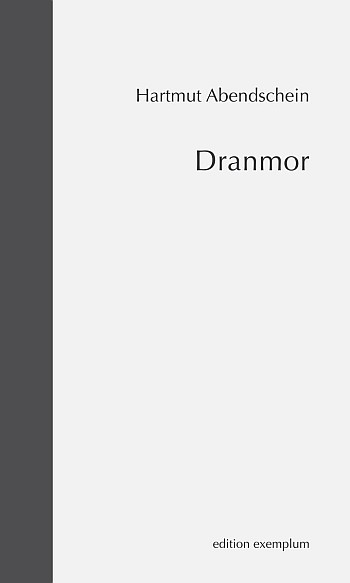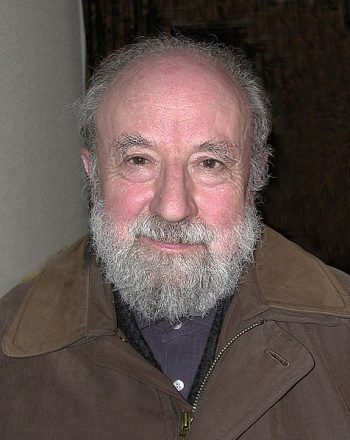Menschen | Werner Otto Müller-Hill: »Man hat es kommen sehen und ist doch erschüttert«. Das Kriegstagebuch eines deutschen Heeresrichters 1944/45
Er sah, wie das eigene Volk sich ins Verderben stürzte, er begriff die Hybris und den Wahnsinn der nationalsozialistischen Führung, er fühlte die Schuld, die das braune System auf sich lud – und war dennoch Teil der militärischen Elite. Werner Otto Müller-Hill beschreibt in seinen Kriegstagebüchern, wie er versuchte, aufrecht zu bleiben. »Man hat es kommen sehen und ist doch erschüttert« ist ein beklemmendes Zeitdokument, dessen analytische Schärfe verblüffend ist. Von VIOLA STOCKER
 Werner Otto Müller-Hill wird 1885 als Sohn eines Ingenieurs in Freiburg im Breisgau geboren. Er studiert Jura, dient im Ersten Weltkrieg als Kriegsrichter und arbeitet in der Weimarer Republik als Anwalt. Ab 1940 leistet er Militärdienst als Heeresrichter, seit 1942 in Straßburg. Am 27. März 1942, dem Tag seines 59. Geburtstags, beginnt er sein Tagebuch. Werner Otto Müller-Hill überlebt den Zweiten Weltkrieg und wird Oberstaatsanwalt in der Bundesrepublik. Er stirbt 1977.
Werner Otto Müller-Hill wird 1885 als Sohn eines Ingenieurs in Freiburg im Breisgau geboren. Er studiert Jura, dient im Ersten Weltkrieg als Kriegsrichter und arbeitet in der Weimarer Republik als Anwalt. Ab 1940 leistet er Militärdienst als Heeresrichter, seit 1942 in Straßburg. Am 27. März 1942, dem Tag seines 59. Geburtstags, beginnt er sein Tagebuch. Werner Otto Müller-Hill überlebt den Zweiten Weltkrieg und wird Oberstaatsanwalt in der Bundesrepublik. Er stirbt 1977.
Kein Blutrichter
Der Militärhistoriker Wolfram Wette, der seinerzeit auch zur Filbingeraffäre veröffentlichte, klärt in seinem Vorwort viele Fragen, die man sich sonst im Laufe der Tagebuchlektüre stellen würde. Die prominenteste darunter ist wohl, wie Werner Otto Müller-Hill kein Nationalsozialist sein konnte, wie er sich über offensichtliche Direktiven hinweg setzen oder sie zumindest ignorieren konnte. Denn das Oberkommando der Wehrmacht hatte in einem Erlass von 1942 verdeutlicht, dass die Richter fest in der nationalsozialistischen Weltanschauung verhaftet sein sollten.
Allerdings macht Wette im Prolog auch deutlich, dass Müller-Hill hauptberuflich Rechtsanwalt war und nur im Zuge der weiterschreitenden Mobilisierung als Reserveoffizier und später als Oberstabsrichter beim Feldkriegsgericht der Ersatz-Division 158 in Straßburg eingesetzt wurde. Genau diese Sonderstellung ermöglichte wohl Müller-Hill diese eigenwillige Handhabung staatlicher Direktiven.
Innere Opposition in der äußersten Bedrängnis
Der Wehrmachtsrichter protokolliert in seinen Aufzeichnungen, die nachweislich während der Kriegszeit entstanden waren, detailliert seine oppositionelle Einstellung. Anhand seiner Informationsquellen, NS-Zeitungen, Wehrmachtsberichte, ausländische Rundfunksender und nicht zuletzt Äußerungen aus der Offiziersmesse, kommentiert er die militärische Lage und mutmaßt über das Schicksal Deutschlands nach Kriegsende. Dass Deutschland den Krieg verlieren würde, stand für ihn außer Frage.
Warum aber schreibt Müller-Hill? Ihm war, das wird nach oberflächlicher Lektüre schnell klar, zutiefst bewusst, dass die Entdeckung seines Tagebuchs das Ende seiner beruflichen und höchstwahrscheinlich auch privaten Existenz bedeuten würde. Immer wieder weißt er auf die rechtsfreien Räume im NS-Regime hin und klagt die sogenannten »Blutrichter« an. Er betont stets, dass er versuchte, nach bestem Wissen und Gewissen Recht für die angeklagten Soldaten zu sprechen, die er in Schutz nimmt.
Dokumentation eigener Unschuld
Nach dem Zweiten Weltkrieg kann Müller-Hill in einem Entnazifizierungsverfahren nachweisen, dass er weder der NSDAP noch ihren zugehörigen Organisationen beigetreten war. Dies sichert ihm eine weitere Karriere als Richter in der entstehenden Bundesrepublik. Mit Sicherheit hat er sein Tagebuch auch unter diesem Aspekt geführt, nämlich in der Hoffnung, es könnte ihm beim Neuanfang nach dem Krieg entsprechende Dienste leisten. Er führt sein Tagebuch regelmäßig und akribisch, selbst im Hospital verfasst er nach einer Verletzung weiter Einträge.
Aus ihnen geht hervor, dass Müller-Hill vor allem um seine Familie besorgt ist, die in Freiburg unter den Bombenangriffen zu leiden hat. Um derentwillen, so Müller-Hill, verzichtet er auf offene Opposition, um die Existenz der Familie nicht zu gefährden. Gegenüber ausgewählten Personen, denen er meint vertrauen zu können, gibt er sich eigenen Aussagen zufolge direkter und aggressiver. Hier erfährt er viel, vor allem von der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung seiner Gesprächspartner. Aber auch vom blinden Führerglauben anderer Offiziere und Beamter.
Fast fehlerlos
Müller-Hills Tagebuch bewegt durch die Wut, die der Autor dem System gegenüber verspürt genauso wie durch die Logik und Scharfsinnigkeit, mit der er politische und militärische Vorgänge dokumentiert. Um seine Darstellung zu untermauern, schreibt er Zeitungsartikel ab oder fügt sie bei. Leider sind die Zeitungsartikel bis auf einige der Abschriften nicht in die Edition eingefügt worden. So ist für den Leser meist schwer nachzuvollziehen, welche Argumente Müller-Hill widerlegen möchte, vor allem, wenn er widersprüchliche Aussagen von Partei und Militär gegenüberstellt.
Im Anhang findet sich ein ausführliches Personenverzeichnis, auch Abkürzungen, die Müller-Hill benutzt, werden erklärt sowie einzelne historische Ereignisse, die die Eintragungen betreffen. Auch hier vermisst man die Zeitungsartikel. Selbst im Fall des Verlustes der Originalartikel hätten die Herausgeber versuchen können, die betreffenden Textstellen in Archiven zu suchen. Diese offensichtliche Unterlassung lässt vermuten, dass Müller-Hills Tagebuchedition versucht, den Erfolg ähnlicher Veröffentlichungen zu kopieren, ohne deren Gründlichkeit mit zu übernehmen. Nichtsdestotrotz findet man hier das Zeugnis eines kritischen Geistes, der sich von der Diktatur nicht gleichschalten ließ und sich seine eigene Meinung bewahrte.
| VIOLA STOCKER
Titelangaben
Werner Otto Müller-Hill: »Man hat es kommen sehen und ist doch erschüttert«. Das Kriegstagebuch eines deutschen Heeresrichters 1944/45
Mit einem Vorwort von Wolfram Wette
München: Siedler 2012. 176 Seiten. 19,99 Euro