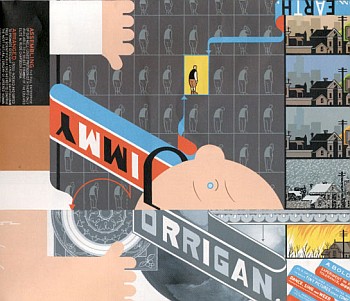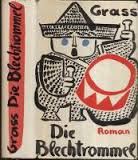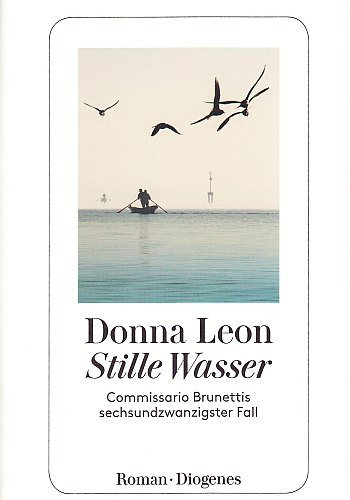Menschen | Max Paul Maria
Eine zufällige Begegnung mit dem Musiker Max Paul Maria. Was ist seine Geschichte – und wie inszeniert er seine musikalischen Projekte, die sich zwischen Liebhaberobjekten und professionellem Anspruch bewegen? Da ihr bloße Internetrecherchen nicht ausreichten, hat PATTY SPYCHALSKI ihn befragt und einen Tag lang begleitet.

Auf Max Paul Maria und seine Band Diving For Sunken Treasure traf ich zufällig im Rahmen eines privaten Konzerts. Krachiger, schneller Gypsy-Punk, absolut tanzbar und energiegeladen. Zu Hause suchte ich bei YouTube und fand heraus, dass Max Paul Maria auch solo Musik macht. Ich klickte ein paar Lieder seines Albums Miles and Gallons an – und war sofort begeistert.
Folk Songs, akustische Gitarre, Mundharmonika und eine rauchige Stimme – mehr nicht. Auf einem seiner Konzerte kaufte mir nach dem Auftritt seine Platte – auf dem Heimweg war ich dann allerdings irgendwie bedrückt und blieb es auch, als ich das Album das erste Mal hörte. Erst beim nächsten Hören kam ich dann darauf, dass es die Texte waren, die mich auf so eine seltsame Art berührten. Wenn er davon singt, wie er mit seiner Plastiktüte voller Erinnerungen am Bahnsteig steht und den Zügen Richtung Westen nachschaut. Wie er durch die grauen Straßen von Berlin läuft, mit einer Sehnsucht in seinem Herzen und hofft » … tomorrow maybe it´s gonna be alright!« Irgendwas daran verursachte mir Bauchschmerzen.
Ich recherchierte ein wenig im Netz über ihn, fand aber nicht genug für all meine Fragen und beschloss schließlich, ihn direkt zu fragen …
»Bekannter Fremder«
Ich treffe Max Paul Maria im Görlitzer Park. Plötzlich werde ich aufgeregt, als mir auffällt, dass ich fälschlicherweise davon ausging, jemanden zu treffen, den ich schon kenne – nur weil seine Platte bei mir in den letzten Tagen rauf und runter lief. Und es ist auch bloß seine abgewetzte Jeansjacke, die mir von Fotos bekannt vorkommt und diese Cowboyboots. Ansonsten ist er für mich ein fremder Mensch.
Ich muss schnell umdenken.
Max macht es mir allerdings leicht. Er begrüßt mich mit einer Umarmung, lächelt viel und ist wirklich sehr nett. Wir kommen gut ins Gespräch.
Er kommt aus Freiburg. Mit zehn Jahren hat er angefangen Gitarre zu spielen. Klassische Musik erst mal. Dann folgten die ersten Bands: Primate Society, LeChuck – lauter, zorniger Punkrock. »Da musste alles erst mal raus!«, lacht Max.
Aber auch damals mochte er schon die geerdete Stimmung von Folkmusik.
Schnell wurde Freiburg für ihn zu klein. Er leistete seinen Zivildienst in Berlin, kochte in einem Kindergarten das Mittagessen und gründete nebenher mit Kumpels die Band Diving For Sunken Treasure.
»Diving ist eine Partyband«, erklärt Max und dreht sich eine Zigarette. »Wir haben als Straßencombo angefangen. Sind von einer Bar zur nächsten gezogen und haben dort ein paar Songs gespielt. Es gab immer Leute, die sich uns angeschlossen haben und uns in den nächsten Laden gefolgt sind. Am Ende des Abends waren wir ein großer Pulk von Leuten. Diving ist nicht nur Musik, da gehört das ganze Programm dazu. Party und natürlich auch Alkohol. Klar ist das aufregend und macht viel Spaß, aber drei Wochen mit der Band auf Tour sind echt brutal.«
Wenn er alleine ein Konzert gibt, geht es etwas ruhiger zu. Es sind meist kleinere Bars oder Kneipen, die Max sich sucht und anfragt, ob er dort spielen kann.
»Ich bin früher oft im Soulcat aufgetreten. Eine Bar in Kreuzberg. Das war eine gute Schule. Es ist ein Laden, wo etwa 50 Leute reinpassen, davon 30 laute Spanier. Da musste ich auch erst mal lernen, dass man nicht immer lauter wird und anfängt zu schreien, statt zu singen, sondern eher leise sein Ding macht, konzentriert bleibt.«
Seine Musik erinnert an die großen Songwriter. Nick Cave, Leonard Cohen, Tom Waits. »Und spätestens wenn ich die Mundharmonika auspacke ist sofort die Assoziation Bob Dylan da. Da kann man nichts machen«, grinst er.
»Kurz gefasst? Das geht nicht!«
Max Paul Maria ist in der Welt beheimatet: Gleich nach dem Zivildienst ist er auf Reisen gegangen. Brasilien, USA, Asien, ein Jahr lang hat er in Lissabon gelebt und dort Portugiesisch gelernt.
»Ich glaube, es ist wichtig, die Realität von der Welt zu erfahren. Du hast da so eine Landkarte mit ihren Konturen, ein Stück Papier, dann steigst du ins Flugzeug und zehn Stunden später wieder aus und bist plötzlich auf der anderen Seite der Erde. Das ist schon verrückt.«
Mein Eindruck ist, dass Fernweh und die Sehnsucht nach einem anderen Leben all seine Lieder durchziehen. Aber als ich Max bitte, sein großes Thema in wenigen Worten zusammenzufassen, lächelt er nur und schüttelt den Kopf. »Nee. Das geht nicht. Egal was ich sagen würde, es würde platt klingen. Es steckt halt in den Songs.«
Mir dämmert langsam, dass dieses Fernweh auch das ist, was mir an seinen Liedern Bauchweh bereitet hat. Möglicherweise ist es auch mein Thema, mit dem ich mich bisher zu wenig auseinandergesetzt habe.
»Eine Sache hat mich auf all meinen Reisen am meisten beschäftigt«, fährt er fort. »Als ich unterwegs war, kam nie der Punkt, wo ich dachte: Hier will ich bleiben.«
Zwei Jahre lang hat er nur aus einem Koffer gelebt, ist von Wohnung zu Wohnung gezogen und hatte alles, was er brauchte immer mit dabei. »Es war eine gute Erfahrung zu merken, dass es geht.«
Aber jetzt will Max erst mal eine Weile in Berlin bleiben. »Ist definitiv die beste Stadt um Musik zu machen. Viele Auftrittsmöglichkeiten, viele Kontakte.«
Das große Ziel ist es, ein Label zu finden, einen Plattenvertrag an Land zu ziehen, um seine Solonummer auf professionelle Beine zu stellen.
Zwölf neue Songs sind schon geschrieben.
»Ich bin auch gerade satt von der einsamen Singer/Songwriternummer. Die neuen Sachen sind anders. Weniger akustisch, mehr elektrische Gitarre. Ich suche auch nach einer Band, mit der ich die neuen Sachen umsetzen kann. Ein bisschen in die Richtung Velvet Underground. Die Basis bleibt natürlich, aber es gibt andere Bilder und eine neue Soundästhetik.«
Abends begleite ich Max Paul Maria auf sein Konzert im Café Tasso, einem Antiquariat. Das Publikum ist anders als in den Kneipen und Bars.
»Das ist super. Ich mag es, wenn Leute sitzen und einfach nur zuhören. Ist eine ganz andere Konzentration.«
Jedes Mal, wenn ein Lied fertig ist und die Leute anfangen zu klatschen, dreht Max sich weg, um ein Schluck Bier zu trinken oder die Gitarre umzustöpseln, fast so, als würde der Applaus ihn verlegen machen.
Die Leute mögen das, was er auf der Bühne macht. Es lässt sich gut beobachten, wie alle aufmerksam zuhören und ihre Gedanken schweifen lassen, beflügelt von dem, was sie da hören. Das Konzert ist viel zu schnell vorbei, trotz zweier Zugaben.
Max verkauft noch ein paar CDs, plaudert kurz mit seinem Publikum und rauscht schließlich in seinem alten, weißen Mercedes davon.
Ich sitze noch eine Weile da und bin diesmal nicht betrübt, sondern überlege, wo meine nächste Reise hingehen könnte.
| PATTY SPYCHALSKI
Reinschauen
Webseite
Max Paul Maria auf Facebook
Max Paul Maria – Downtonwn Live