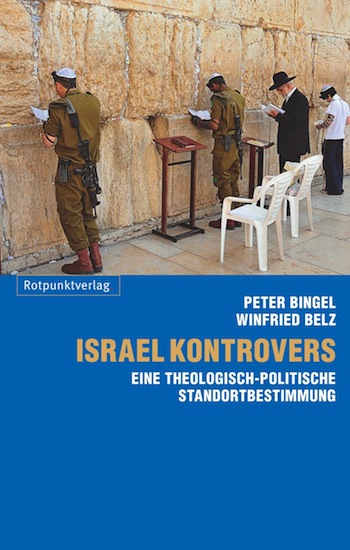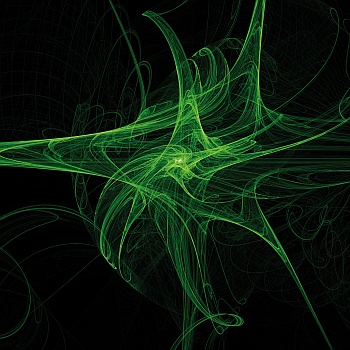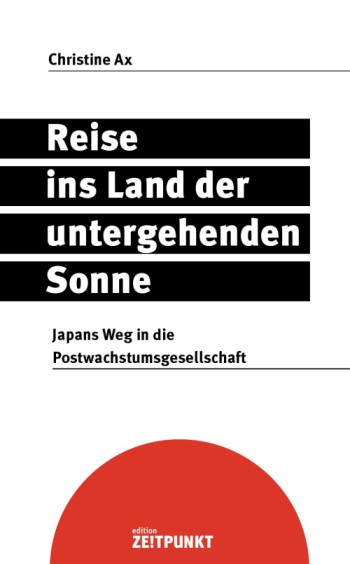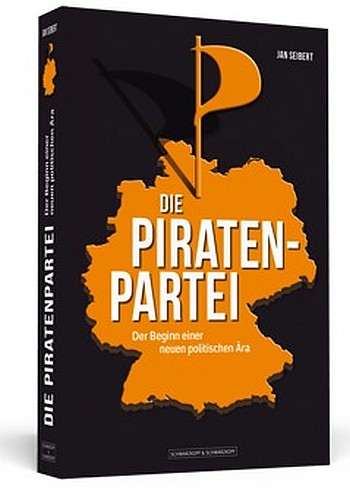Gesellschaft | Bingel / Belz: Israel kontrovers
Die evangelischen Kirchen in Deutschland sind für ihre Israelfreundlichkeit bekannt, die oft jede kritische Distanz zur aktuellen zionistischen Politik von Aggression und Repression vermissen lässt. Das ist ärgerlich für alle, die sich für einen gerechten Frieden im Nahen Osten einsetzen, der auch die Interessen der Palästinenser berücksichtigt. Die beiden Theologen Peter Bingel (Königswinter) und Wilfried Belz (Wilhelmsfeld) führen in Israel kontrovers die Israelnähe der organisierten deutschen Protestanten auf spezifisch theologische Weichenstellungen zurück. Von PETER BLASTENBREI
Die Autoren kritisieren damit die »Theologie nach Auschwitz«, die sich bei den Protestanten seit den 70er Jahren entwickelt hat und mit Namen wie Jürgen Moltmann, Franz Mußner und Klaus Wengst verbunden ist. Einiges haben sie dieser Theologie vorzuwerfen: unzulässige Vermischung des alten Israel, der jüdischen Religion und des modernen Staates Israel, Vernachlässigung der universalen christlichen Ethik und ganz zentral die Christologie. Damit ist die Neudefinition Christi gemeint, der hier als Bindeglied zum Gott des Alten Testaments und seinem Volk verstanden wird, und nicht wie traditionell allein als Messias und Welterlöser und damit als trennende Gestalt gegenüber dem Judentum.
Damit tragen Bingel und Belz eine innerkirchliche Kontroverse in die Öffentlichkeit, die so alt ist wie die »Theologie nach Auschwitz« selbst. Weder Inhalt noch Berechtigung dieser Theologie oder die hier vorgetragene Kritik kann Gegenstand dieser Rezension sein – dazu fehlt dem Rezensenten die Kompetenz ebenso wie der Glaube, dass sich theologische Streitfragen rational klären ließen. Zu dem Vorhaben einer theologischen und politischen Standortbestimmung und den Aussagen des Buches zum Kern des Palästinakonflikts, lässt sich aber wohl etwas sagen.
Kontroversen
Die Kritik an der neuen protestantischen Theologie, so zentral sie ist, setzt erst spät im Buch ein (auf S. 92). Der katholische Bereich kommt mit einem kurzen, übersichtlichen Referat der Äußerungen von Päpsten und Bischöfen zum Verhältnis Juden-Christen aus. Definitionen sind hier eindeutig, kohärent und damit problemlos: Israel ist das Gottesvolk des Altertums, heute geht es um Juden (soweit nicht ausdrücklich vom Staat Israel die Rede ist), die Rechte der Palästinenser bleiben im Blick. Ebenso problemlos ist das Kapitel zu den Evangelikalen, die meist ohne echte theologische Grundlage als radikale christliche Zionisten auftreten.
Mehr als die Hälfte des Buches erzählt die Geschichte des Judentums. Tatsächlich geht es hier aber fast allein darum, die seltsame Erkenntnis einzuschleifen, Juden hätten von Anfang an »eine untrennbare Einheit von ethnischer Gemeinschaft und Religionsgemeinschaft« (S. 18) gebildet. Über weite Strecken wird auf jeder Seite »die völlige Identität« beider Gemeinschaften behauptet, denn beweisen kann man so etwas natürlich nicht. Wohl aber leicht das Gegenteil.
Fast die gesamte jüdische prophetische Literatur ist ja motiviert von der verlorenen Identität der Jahweverehrer und der hebräischsprachigen Einwohner Palästinas, die immer wieder andere Kulte bevorzugten. Die Existenz einer vorchristlichen Übersetzung der jüdischen heiligen Schrift ins Griechische (Septuaginta) schließlich belegt eindruckvoll, dass es lange vor der Zeitenwende Juden gab, die nicht hebräisch sprachen.
Kontinuitäten
Aber es geht gar nicht um eine saubere althistorische Beweisführung. Das Beharren auf dem unwandelbar exklusiven, nationalen Charakter der Jahwereligion dient dazu, die Ansätze der »Theologie nach Auschwitz« endgültig zu kippen (S. 95). Denn wenn bei den Juden Volk, Nation und Religion identisch sind, kann Christus kein Mittler zwischen Christen und Juden sein und schon gar nicht zu dem ihm fremden Gott des Alten Testaments hinführen. Diese Interpretation treibt entsprechende Blüten. So wird den heutigen deutschen Juden wegen ihrer angeblichen doppelten Volkszugehörigkeit allen Ernstes eine doppelte Verantwortlichkeit für Deutschland und Israel zugemutet (S. 108-110).
Überhaupt kommen Juden in dem Buch nicht gerade gut weg. Ihre Religion ist – anders als das Christentum – politisch, national und exklusiv. Ihr Verhältnis zu den Christen war von vorneherein belastet durch Verfluchung und »Christenverfolgung durch das jüdische Establishment« (S. 61). Dementsprechend wird die Verantwortung der christlichen Kirchen für Diskriminierung und Verfolgung der Juden in Europa minimiert. Schließlich weiß man ja nicht, »ob andere Kräfte dahintersteckten« (S. 63). Selbst die alte Mär fehlt nicht, Luthers extrem judenfeindliche Spätschriften hätten erst die Nazis wieder ausgegraben.
Wissenslücken
Beide Autoren sind in der Palästinaarbeit tätig, merken aber nicht, wie sehr ihre Argumentation gerade den bedrängten Palästinensern in den Rücken fällt. Denn jahrtausendealte Kontinuität des jüdischen Volkes ist die Kernthese des politischen Zionismus, nicht, wie hier irrtümlich angenommen, staatliche Kontinuität in der Antike (S. 24). Und selbstverständlich hatte der Zionismus von vorneherein eine nationalreligiöse Komponente: ohne die nationalistisch uminterpretierten heiligen Texte ließ sich eben kein jüdisches Volk herbeifantasieren.
Der Ignoranz der Autoren über den Zionismus entspricht ihr Unwissen über das talmudische Judentum. Ihre Behauptung, die religiösen Juden hätten sich nach 1945 »von Gott verlassen« dem Zionismus zugewandt (S. 85-87), unterschlägt die vielfältigen jüdischen theologischen Antworten auf Auschwitz. Nationalreligiöse und »Orthodoxe« sind in der Folge schuld an Israels Verbrechen, einen religiösen Antizionismus gab und gibt es nicht.
Endlose Wiederholungen, begriffliche Unklarheiten und ein manchmal fast monomanischer Stil erschweren die Lektüre. Punktuell steht das Buch dem religiösen, nichtrassistischen Antisemitismus zudem gefährlich nahe, ob bewusst, sei dahingestellt.
Sein Schlusswort verlangt »Information, Klärung und Aufklärung« im Umgang mit Israel – eben das leistet es nicht.
| PETER BLASTENBREI
Titelangaben
Peter Bingel / Wilfried Belz: Israel kontrovers. Eine theologisch-politische Standortbestimmung
Zürich: Rotpunktverlag 2013
173 Seiten. 12 Euro