Interview | Im Gespräch: Autor Anselm Neft
Vor 15 Jahren war Anselm Neft zwei Jahre Mitglied der Mittelalterband Schelmish, die sich Ende 2012 auflöste. Mittlerweile ist er Schriftsteller und Mitherausgeber von ›EXOT. Zeitschrift für komische Literatur‹. Nun ist im August sein Roman ›Helden in Schnabelschuhen‹ erschienen, der in der Mittelalterszene spielt. MARTIN SPIESS, der selbst von 2010 bis 2014 mit seinem Comedy-Duo ›Das Niveau‹ auf Mittelalterfestivals unterwegs war, hat ihn zum Gespräch getroffen.
 Anselm, du bist 1999 und 2000, also in einer ganz anderen Zeit dieser Mittelaltermärkte groß beziehungsweise sozialisiert worden als ich. Der Witz ist aber, dass sich nicht viel verändert. Hast du deswegen, in der Hoffnung, dass sich nicht viel verändert hat, erst so spät das Buch geschrieben?
Anselm, du bist 1999 und 2000, also in einer ganz anderen Zeit dieser Mittelaltermärkte groß beziehungsweise sozialisiert worden als ich. Der Witz ist aber, dass sich nicht viel verändert. Hast du deswegen, in der Hoffnung, dass sich nicht viel verändert hat, erst so spät das Buch geschrieben?
Zum einen glaube ich, dass Erfahrungen eine Weile brauchen, um sich zu setzen, um sich zu etwas zu formen, das literarisch verwertbar ist. Und zehn Jahre sind manchmal ein guter Zeitraum. Man hat Abstand und ist dem Stoff selbst gerechter geworden in der eigenen Entwicklung. Man sieht auch klarer, weil man nicht mehr so drin ist. Und zum anderen habe ich tatsächlich gehofft, dass das, was ich früher erlebt habe, sich substanziell nicht groß geändert hat. Hab mir aber noch ein paar Märkte und Festivals angeguckt und festgestellt, dass es zwar ein, zwei neue Bands gibt und ein, zwei neue Trends, aber dass es im Großen und Ganzen dieselbe Szene ist.
Mittelaltermärkte sind eine sehr anachronistische Welt. Liegt es an dieser Welt aus vergangener Zeit, dass sich eben nichts ändert?
Ja. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es Überschneidungen von den Mittelaltermarktfans zu der Szene des Heavy Metal gibt, weil das auch eine sehr traditionelle, konventionelle Szene ist. Wo zwar immer mal wieder originelle Dinge passieren, aber das Gros argumentiert so: »Ja, die ersten zwei Iron-Maiden-Platten waren die besten.« Oder: »Wenn Metallica noch mal so spielen würde wie auf ›Kill em All‹, dann wär’ alles in Ordnung.« Da will man gar keine Veränderung, da will man eine oft auch jugendliche Atmosphäre konservieren und da drin bleiben. Das klingt ein bisschen allgemeingültiger, als ich es meine, aber ich denke, das sind im neutralen Sinn konservative Milieus. Die wollen etwas bewahren. Und es geht ums Wohlfühlen.
Genau. Man muss nicht unbedingt die Eskapismus-Keule schwingen, aber wenn der Ort immer derselbe ist, in den man eben ausbricht aus der Realität, dann fällt man einem der Ausbruch und das Darin-Wohlfühlen umso leichter.
Ich finde es interessant, dass man bei Leuten, die zu Fantasy-Drachen-Metalbands oder auf Mittelaltermärkte gehen, von Ausbruch aus der Realität spricht, aber bei Leuten, die auf ein Jazz-Konzert gehen, würde man das nicht sagen.
Da heißt es dann: »Jazz ist kultiviert.« Und diese Haltung ist bigott.
Ich denke, das ist so ein bisschen ein Herrschaftsdiskurs. Die Intellektuellen, die den guten Geschmack haben, können darüber urteilen und sagen: »Ja, das sind ja so die Menschen, die flüchten in ihre Gegenwelt.« Als ob jemand, der tausend Bücher liest, nicht auch in eine andere Welt flüchtet.
Warum ist es Eskapismus, wenn man Live-Rollenspiel macht, aber es ist kein Eskapismus, wenn man ins Kino geht?
Genau.
Wie bist du dazu gekommen, mit einer Mittelalterband zu touren?
Ich hab schon mit 13 ›Das schwarze Auge‹ entdeckt, durch einen älteren Freund. Ich war dann viele Jahre Spielleiter einer Rollenspielrunde, in der wir auch viel fantasiert haben, wie es wäre, in so einer Welt zu leben. Wir haben uns Klamotten genäht, uns nachts im Wald getroffen und am Lagerfeuer Geschichten erzählt. Und dann hat einer von uns gelesen, dass es in Frankreich Live-Rollenspiele gibt. Er hatte ein französisches Spielemagazin und da war ein Bericht des ersten Live-Rollenspiels drin, Mitte der 80er.
Wir fahndeten, ob es das in Deutschland gibt, und lernten eine Frau kennen, die ein Kelten-Lager betrieb. Wir sind auf ihren Hof gefahren, haben ihre Leute getroffen und fanden das großartig, dass jemand das so nachstellt – das war ja eher Reenactment. Die hat auch das erste Live-Rollenspiel mit uns besucht.
Durch diese Live-Rollenspielszene bin ich auf Burgfeste gekommen, wir hatten unsere Klamotten ja schon, wir hatten Stahlschwerter und haben Schaukampf gemacht. Wir haben Lauten-Musik gemacht und gesungen und uns irgendwann mit alten Freunden zusammengetan, die gar nicht in der Szene unterwegs waren, sondern sich gegründet hatten, um auf der Geburtstagsparty der Mutter des Bandleaders zu spielen. Aber eben dieser Bandleader dachte: »Ich habe Bock, ne richtig fette Band an den Start zu bringen.« Der war früher lange Zeit als Irish-Folk-Musiker unterwegs gewesen und wollte das wieder machen, merkte aber, dass man mit Irish Folk keinen Blumentopf gewinnen konnte, aber dass die Mittelalterszene kommt. Und er hatte recht. Da – bei Schelmish – habe ich gegen Ende meines Studiums knapp zwei Jahre mitgemacht.
Wie war das für dich?
Ich erlebte, dass es eine tolerante und offene Szene ist. Dass man sich einfach immer freut, dass jemand dabei ist: Ob du dick bist oder dünn, doof oder schlau, guten Geschmack hast oder nicht, am Instrument was kannst oder nicht – die Leute sind dir sehr wohlgesonnen. Was auch bedeutet, dass, wenn du ein bisschen eloquenter bist, sich viele darüber freuen. Ich sag es mal ein bisschen provokativ: Mit dem musikalischen Know-how kommt man als Rockband nicht weit, als Mittelalterband aber unter Umständen schon. Wie bei Schelmish am Anfang – mal von zwei Musikern abgesehen, die das konnten. Ich konnte nicht viel an der Flöte oder Schalmei. Aber die Leute fanden es toll, wenn ich da in die Tröte geprustet habe, weil die gar nicht so sehr wollten, dass es gut oder perfekt ist …
… sondern, dass es mitreißt.
Dass es mitreißt. Dass die Show stimmt und dass die Stimmung da ist.
Mir war gar nicht bewusst, dass du da wirklich auch Musiker warst.
(lacht) Das würden die vielleicht auch nicht sagen, dass ich Musiker war.
Ich dachte, du habest Schelmish in deiner Funktion als Schriftsteller begleitet, mit dem festen Vorhaben, ein Buch daraus zu machen.
Das hätte nicht funktioniert.
Das habe ich mich nämlich gefragt: Wie hat das funktioniert, dass er, um für dieses Buch zu recherchieren, die Band zwei Jahre begleitete?
Ich glaube, es wäre seltsam gewesen, wenn ich gesagt hätte: »Ich will ein Buch über die Szene schreiben und reise jetzt mal zwei Jahre mit Schelmish mit.« So etwas kann funktionieren, wenn die Chemie gut stimmt. Aber ich finde es einen etwas künstlichen Ansatz. Darüber zu schreiben kam viel später. Außerdem ergibt so etwas wie die Mittelalterszene ja noch keinen Plot. Irgendeine Szene ist noch keine Geschichte. Und der Kern eines Buches ist eine Geschichte: ein Mensch will etwas unbedingt, irgendetwas hindert ihn daran, es gibt einen Konflikt und wir wollen wissen: Wie geht es weiter?
Es ist bezeichnend, dass genau die Vermutung, die ich hatte – du wärest mit denen als Autor zu Recherchezwecken mitgereist, als jemand, der von außen an diese Szene herantritt – sich im Plot des Buches wiederfindet. Da sind Max und Katja, zwei Figuren, die in diese Szene geraten, weil sie zwischen Abschluss ihres Philosophie-Studiums und Beginn der Dissertation Geld verdienen müssen. Katja will ihr Philosophieren im Nicht-Uni-Volk ausprobieren. Und Max, der Ich-Erzähler, muss schon alleine deshalb dabei bleiben …
Das ist ganz spannender Punkt, weil ich während der Lektüre immer wieder dachte: »Wann kommt der Moment, in dem der Ich-Erzähler, und sei es nur in einem Halbsatz, mal kommentiert: ›Ich bin kacke drauf, weil ich die Frau nicht kriege. Und deswegen finde ich diese Szene und ihre Menschen so scheiße.‹« Ich hab immer wieder gedacht: »Oh, ist das zynisch. Wann kommt der kathartische Moment, wo er sagt: ›Ich hab das alles nur scheiße gefunden, weil ich die Frau nicht hatte.‹« Hast du dich ganz bewusst dagegen entschieden, ihn das irgendwann ganz explizit sagen zu lassen?
Ich wollte es nicht so explizit machen, nein. Ich wollte da nicht so einen Moment haben, sondern lieber an vielen kleinen Details zeigen, dass da eine leichte Verschiebung stattfindet. Er ist nicht nur sauer, weil er die Frau nicht kriegt und da mitfahren muss. Sondern er hat schon ganz am Anfang dem Banker gegenüber, der sie in die Band holt, diese ablehnende Haltung. Er ist ein griesgrämiger Mensch. Der ist einfach voller negativer Emotionen, aber er merkt, dass die Leute in dieser Szene, die er so verächtlich betrachtet, ihn so nehmen wie er ist, auch seine Spinnereien durchgehen lassen. Und ihn nicht dafür verurteilen, dass er fett ist, dass er geschwollen daherredet, dass er nicht so gut Schalmei spielen kann. Und sie lassen ihn sogar noch Bauchtanz machen!
Es wird ihm irgendwie klar: »Moment mal – die Leute sind eigentlich ganz schön okay auf ihre Weise, auch wenn das hier vielleicht nicht meine Hood ist.« Er fühlt sich dann doch, auch wenn das vielleicht nicht ganz so explizit gesagt wird, mehr und mehr damit verbunden, zeigt sich mehr und mehr und bringt sich auch mehr und mehr ein. Und wird weniger hasserfüllt und am Ende immer milder.
Also gibt es keinen einen großen Moment, weil es dir zu holzhammerartig gewesen wäre?
Ja, das ist so hollywoodmäßig, wenn jemand am Anfang alles scheiße findet und am Ende alles gut. Das würde auch nicht stimmen. Ich finde, dass man schon merkt, dass er gerührt ist, beim letzten Auftritt sogar weint, aber sich dann wieder dagegen wehrt und sagt: »Ach Gott, ist auch höchste Zeit, dass ich hier aufhöre.« Ich denke schon, dass ihm das ans Herz gewachsen ist. Im Nebensatz sagt er immer mal wieder was Positives, aber er kann das nicht so dauerhaft stehen lassen.
Sein Hadern mit der Szene ist also nicht als Kritik zu verstehen?
Nein. Ich hab mir nicht gesagt: »Ich schreib jetzt ein Buch über die Mittelalterszene«. Ich hab mir gesagt: „Ich schreibe ein Buch über eine verquere Liebesgeschichte und über die Frage: »Was kann die Königin der Wissenschaften, die Philosophie, heute eigentlich noch leisten?« Sie hat doch einen riesigen Relevanzverlust hingenommen. Was machen eigentlich solche Geisteswissenschaftler nach dem Studium? Soll man sich hinstellen und wirklich mal Philosophie ins Volk tragen? Oder ist das total lächerlich? ›Helden in Schnabelschuhen‹ ist keine kritische Auseinandersetzung mit der Mittelalterszene, sondern mit Intellektuellen: Warum sind die so, wie sie sind? Was sind ihre Motive? Was können sie beitragen und was eher nicht? Ich denke, Intellektuelle wie Max und Katja haben viele Ängste und versuchen, Kontrolle zu erlangen, in dem sie eine Schutzmauer aus Gedanken und Wörtern errichten.
Dann könnte man jetzt fragen: Warum spielt das überhaupt in der Mittelalterszene?
Freunde von mir haben das Buch gelesen und gesagt: »Spannende Geschichte mit der Beziehung, spannend auch diese Philosophie-Frage, aber warum musst du das in diese krasse und irgendwie auch derb triviale Mittelalterwelt setzen?« Erstens: Weil ich diese Szene gut kenne und wenn man etwas gut kennt, kann man auch oft gut drüber schreiben, wenn man den Abstand hat. Zweitens: weil noch nie ein belletristisches Buch in dieser Szene gespielt hat. Vor allen Dingen aber drittens: weil diese Intellektuellenwelt sich in ihrer ganzen Stärke und Schwäche, in ihrer Lächerlichkeit erst zeigt, wenn sie außerhalb ihrer Gesetzmäßigkeiten zu funktionieren hat und man plötzlich sieht: Was ihr intellektuell drauf habt, ist nicht das, was zählt, sondern was ihr für Menschen seid. Ob ihr mutig seid oder nicht, ob ihr euch durchsetzen könnt oder nicht, ob ihr freundschaftsfähig seid oder nicht, ob ihr zuhören könnt oder nicht, ob ihr tolerant sein könnt oder nicht, ob ihr eine Schalmei spielen könnt oder nicht.
Das nimmt Max und Katja schon irgendwie mit: dass sie mit einer gewissen Arroganz da reingehen und merken: »Der Spieß dreht sich leicht um, vielleicht sind wir jetzt die, die beobachtet werden.« Es gibt eine Stelle im Buch, in der Max den neuen Lover von Katja kennenlernt, diesen Journalisten, der die Mittelalterszene ein bisschen soziologisch seziert: Eskapismus, Kleinbürgertum, abgehängte Leute. Und Max wehrt sich dagegen. Nicht nur, weil er den Typen abwimmeln will, sondern weil er sich plötzlich berufen fühlt, diese Szene vor Intellektuellen zu verteidigen: »Hör doch auf, du weißt doch gar nichts!« Und das ist eigentlich, was er sich selber vorwirft. Das ist eine Schlüsselszene.
Eine weitere Schlüsselszene ist kurz vor dem Ende, als aufgelöst wird, dass der Waffenspediteurs-Sohn, auf dessen Hochzeit die Band gespielt hat, doch bei seinem Vater in die Firma eingestiegen ist. Obwohl Katja in einer ihrer Moderationen sagt, er solle nicht für seinen Vater arbeiten. Am Ende ist es auch egal, ob es die Mittelalterszene ist …
… oder die Countryszene …
… in die diese Themen hineingesprochen werden. So richtig und so legitim diese philosophischen Moderationen der beiden auch sind: Du kriegst die Leute so nicht erreicht.
Genau.
Es ist so was wie eine Demaskierung dieser philosophisch-intellektuellen Selbstgerechtigkeit.
Es ist ein tragikomischer Abgesang. Philosophie und Intellektualität sind auch eine Strategie, um sich erhaben zu fühlen, um sich über andere zu stellen, sich Menschen und die Welt vom Leib zu halten und sich besser zu fühlen. Aber geleitet von diesen Motivationen ändert man nichts.
Insofern hättest du gar keine bessere Auswahl treffen können, als diese elitäre Intellektuellenwelt zu kombinieren mit der Mittelalterszene, die immer wieder von allen Seiten marginalisiert und deren Anhängern Eskapismus vorgeworfen wird.
Wenn man sich in so einen Philosophenzirkel begibt, kann es sein, dass es da sehr ausgrenzend zugeht: »Der ist dumm, der ist schlau, der hat die falschen Ansichten, der ist moralisch vielleicht gar nicht so integer.« Und dann gibt es ganz viel den falschen Geschmack: »Was? Du hörst die und die Musik? Was? Du hast ne Lava-Lampe zu Hause?« Ein riesiges Distinktionsgebäude, aus dem ganz viele Menschen ausgeschlossen werden. Und in der Mittelalterszene ist das nicht so. Du kannst hier rumlaufen und sein, wie du willst. Das Einzige, was du machen musst, ist dazugehören wollen, also Spaß an der Szene haben und nicht denken: »Oh, was ist das denn für ein Kack?«
Daran ist Folgendes interessant: Wenn man darüber nachdenkt, wie Menschen sich hierarchisieren sollen – anhand des Aussehens, des Geschlechts, der Intelligenz –, würde vermutlich jeder Moralphilosoph sagen: »Um Gottes willen nein! Das darf man nicht, weil Menschen das ja nicht selbst in der Hand haben, wie sie aussehen, ob sie männlich oder weiblich sind, wie klug sie sind.« Das Einzige, wonach sich Menschen hierarchisieren sollten, ist Güte. Und dann guckt man sich einfach die beiden verschiedenen Szenen an und stellt fest: Da haben die Nicht-Intellektuellen anscheinend viel mehr kapiert. Was nicht heißen soll, dass unter den Mittelalterfans keine Intellektuellen rumlaufen. Genauso, wie es auch dumme Philosophen gibt.
Oder andersrum: Es gibt auch Philosophen, die was von Güte und Demut verstehen und es gibt rückwärtsgewandte, homophobe und sexistische Mittelalterfans.
Genau. Ich will aber auch nicht das eine Milieu gegen das andere ausspielen, ich will, dass beide Milieus deutlicher werden aneinander. Das Buch ist die Suche nach dem, was echte Bildung ausmacht, was man sich wirklich zu sagen hat und was jenseits des ganzen Wort- und Distinktionsgeklingels eine Rolle spielen könnte.
Am Ende werden diese ganzen Fragen, die Katja und Max von den Bühnen runterstellen, dem Leser gestellt. Der ist in der Pflicht, sich die Frage zu beantworten: »Was ist das gute Leben? Wie will ich mich anderen Menschen gegenüber verhalten?« Am Ende ist es egal, ob man auf einen Mittelaltermarkt geht oder sich sein Leben aus philosophischen Thesen zusammenbaut. Beides sind Wege, den Schwierigkeiten der Postmoderne zu entgehen.
Manchmal frage ich mich, was passieren würde, wenn die Leute, anstatt ihre Energie in die Ausgestaltung einer Freizeit zu geben, ihre Arbeitsleben verändern würden. Wenn sie so etwas wie eine Revolte machen würden gegen die Ausbeutung, gegen das Abhängigkeitssystem, in dem wir verstrickt sind. Am Anfang und Ende des Romans gibt es politische Ansätze. Am Anfang des Romans mit Helmut Schmidt und dem Gedanken: »Hier geht es vielleicht noch mal um was!« Und am Ende kommt nicht ohne Grund »Wir sind des Geyers schwarzer Haufen«. Das Lied, in dem es um die Bauernkriege geht, und wo Katja und Max auf die Bühne gehen und zusammen singen: »Geschlagen gehen wir nach Haus, die Enkel fechten’s besser aus.«
Ich denke schon, dass die Frage nicht vom Tisch ist: »Wie wollen wir leben?« Und das ist keine Frage nach privater Wellness. Das ist die Frage: Wollen wir so arbeiten, wie wir heutzutage arbeiten? Wollen wir uns so gängeln lassen? Wollen wir Ausbeutungsverhältnisse wie im Mittelalter haben, die aber viel verschleierter sind, wo die Einkommensspannen noch viel größer sind und die Menschen ihren ganzen Hass nach innen richten und sich dadurch selbst kaputtmachen? Wollen wir Zerstreuung als Ersatz für erfüllende Konzentration? Wollen wir Kekse und Fernseherlaubnis von Mutti oder unsere Leben selbst gestalten? Wollen wir Strukturen aufbauen, die es erleichtern, zu lieben, oder solche erhalten, die uns zu Kunden, Konkurrenten, Schuldnern und Gläubigern machen?
Menschen, die das US-amerikanische Modell der pursuit of happiness so extrem verinnerlicht haben, dass sie sich sagen: »Ich streng mich nicht genug an, es muss an mir liegen, dass ich unglücklich bin!«
Genau: »Ich müsste glücklicher sein, ich mache was falsch.« Und dann macht man angestrengter noch mehr von dem alten, strukturell bedingten Scheiß, anstatt ihn infrage zu stellen.
Die Leute, die die Arbeit machen, bekommen immer weniger. Und die, die sie machen lassen, immer mehr.
Womit wir immer noch im Mittelalter wären!
Das ist ein ernüchterndes, aber auch ein tolles Schlusswort. Danke dir, Anselm.
Gerne.
Titelangaben
Anselm Neft: Helden in Schnabelschuhen
München: Knaus 2014
288 Seiten, 14,99 Euro
Reinschauen
| Leseprobe










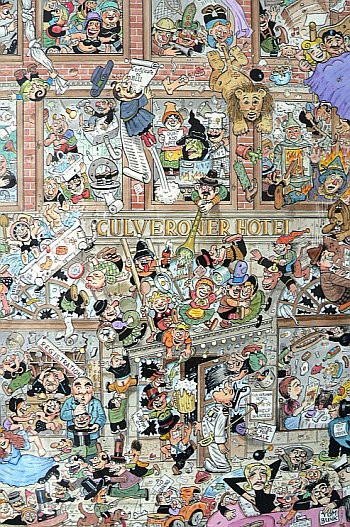
[…] “Das Niveau” treffen. In einer Teestube bat er mich zum Interview. Das Ergebnis kann hier nachgelesen […]