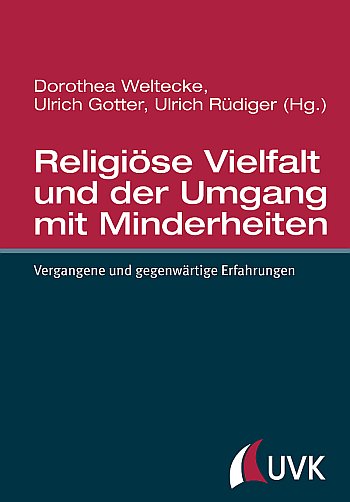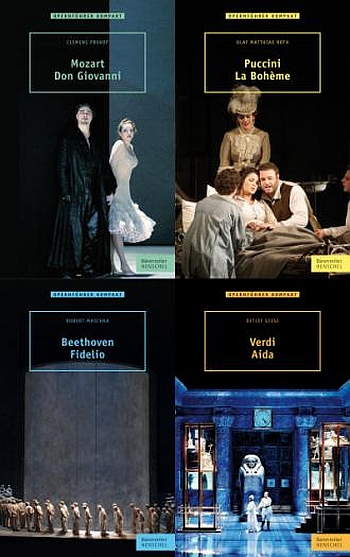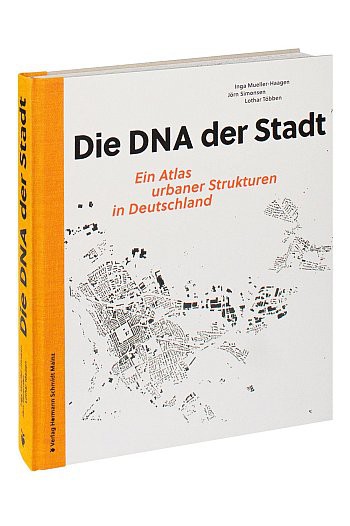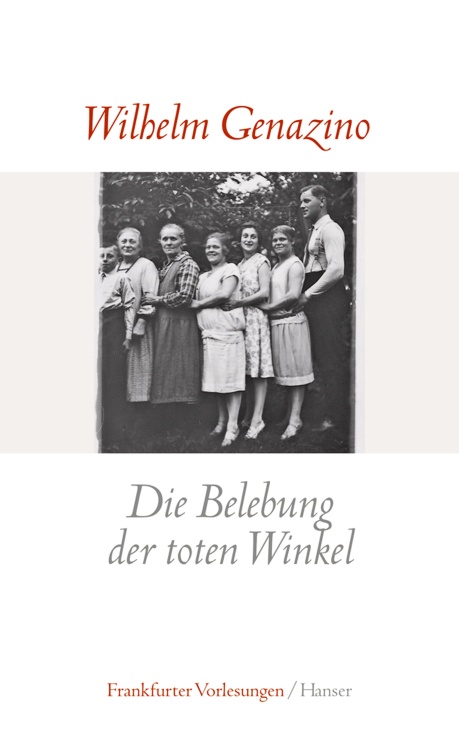Kulturbuch | Dechen Shak–Dagsay: Mantras. Meine Erfahrungen mit der heilenden Kraft tibetischer Weisheit
Dechen Shak–Dagsay wagt mit ihrem Buch über ›Mantras. Meine Erfahrungen mit der heilenden Kraft tibetischer Weisheit‹ einen schwierigen Spagat. Sie will gesungenen tibetischen Dialekt in deutscher Sprache lesbar und zugänglich machen. VIOLA STOCKER findet, dass trotz offensichtlicher akustischer Defizite ein interessanter Einblick in die metaphysische Struktur einer alten buddhistischen Gesellschaft gelungen ist.
 Dechen Shak-Dagsay ist Tibeterin und lebt seit ihrer Kindheit in der Schweiz. Ihre Familie musste im Konflikt um die tibetische Unabhängigkeit das Heimatland verlassen, denn Shak-Dagsays Vater war als Lama ein hoher religiöser Würdenträger und besonders gefährdet. In der Schweiz findet die Familie eine zweite Heimat und Dechen Shak-Dagsay wächst mit sowohl westlichen als auch tibetischen Traditionen auf.
Dechen Shak-Dagsay ist Tibeterin und lebt seit ihrer Kindheit in der Schweiz. Ihre Familie musste im Konflikt um die tibetische Unabhängigkeit das Heimatland verlassen, denn Shak-Dagsays Vater war als Lama ein hoher religiöser Würdenträger und besonders gefährdet. In der Schweiz findet die Familie eine zweite Heimat und Dechen Shak-Dagsay wächst mit sowohl westlichen als auch tibetischen Traditionen auf.
Traditionen in der Fremde bewahren
Schreibt Shak-Dagsay also über die Mantras und die religiösen Traditionen, die sie seit ihrer Kindheit prägen, geschieht dies immer mit dem Blick eines Menschen auf eine verlorene Heimat, deren intellektuelle Reste somit besonders bewahrenswert bleiben. Lange Zeit arbeitet Dechen Shak-Dagsay in der freien Wirtschaft, bevor sie sich als Musikerin der Verbreitung der eigentlich gesprochenen Mantras ihrer Kultur widmet.
Aus dieser Position heraus ist ›Mantras. Meine Erfahrungen mit der heilenden Kraft tibetischer Weisheit‹ verfasst. Dem Leser wird also vorerst nicht nur eine einfühlsame Familiengeschichte erzählt, sondern auch ein tiefer Einblick in die tibetische buddhistische Kultur gegeben. So erschließen sich viele Aspekte dieser Lebens- und Meditationspraxis, die nicht mit einer Religion verwechselt werden darf, dem Leser bereits früh und bieten die Chance, sich, wenn man möchte, näher mit den buddhistischen Praktiken auseinanderzusetzen.
Übersetzungsschwierigkeiten
Shak-Dagsay geht ganz klar an die kulturellen Grenzen, wenn sie ab der Hälfte ihres Buches versucht, die Mantras, die sie auf ihren Konzerten singt und in der Familie praktiziert, für westliche Leser erfühlbar und verstehbar zu machen. Wie sie früh im Buch erklärt, sind die Mantras durch rituelle Silben konstruiert, die sich oft nicht einmal aus tibetischen, sondern vielmehr hinduistischen Dialekten, die viele tausend Jahre alt sind, herleiten. Diese nun ins Deutsche zu übertragen, muss nicht nur scheitern, sondern zerstört unwillkürlich auch die Satzmelodie, durch die die Mantras erst singbar gemacht werden.
Jedes Mantra wird auf tibetisch und dann in deutscher Übersetzung gedruckt. Wobei man davon ausgehen darf, dass auch die tibetische Form eine verwestliche ist, die die Nachsprechbarkeit sicherstellen soll, denn natürlich würde das Originalschriftbild für deutsche Leser unverständlich sein. Die Übersetzung holpert leider so sehr, dass von einem Mantra nicht mehr die Rede sein kann. Auch die starke Metaphorik, die über Jahrhunderte übermittelt wurde, erschließt sich in einer anderen Sprache kaum.
Berührender Einblick in tibetische Traditionen
Was dennoch an Dechen Shak-Dagsays Buch berührt, ist, wie einfühlsam sie es versteht, die geistigen Traditionen ihres Volkes einem weltweiten Publikum zu vermitteln. Auch das Prinzip der Mantras und Meditationstechniken erläutert sie gut und lässt man sich auf ihre Musik ein, erhält man einen sehr genauen Eindruck darüber, was die Mantras in einer tibetisch buddhistischen Meditation bewirken. Letztendlich ist dies genau Shak-Dagsays Fokus, nämlich einem möglichst großen Publikum eine Lebenspraxis nahe zu bringen, die sie für eine heilende und erfüllende Alternative zu westlichen Konsumgesellschaften hält.
Titelangaben
Dechen Shak–Dagsay: Mantras. Meine Erfahrungen mit der heilenden Kraft tibetischer Weisheit
Berlin: Allegria 2014
240 Seiten. 19,99 Euro
Reinschauen
| Leseprobe