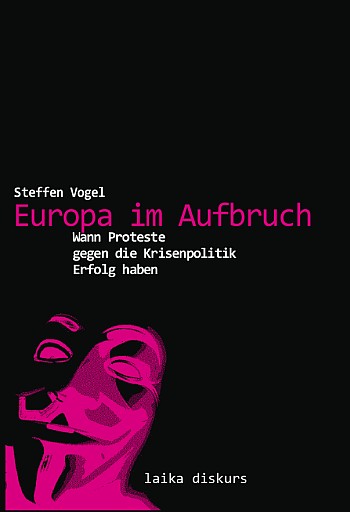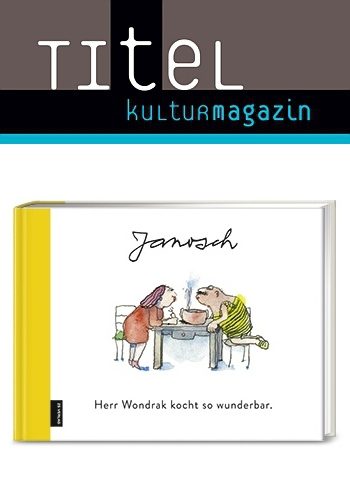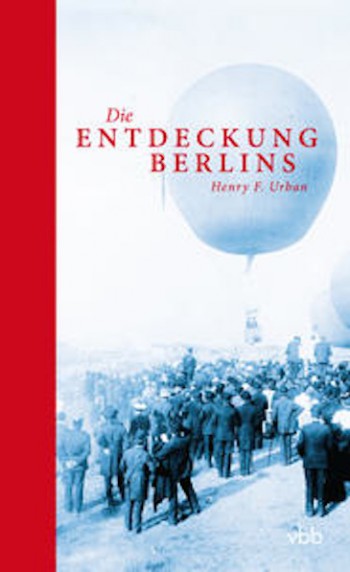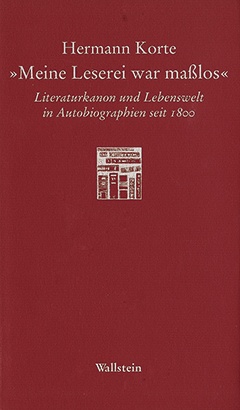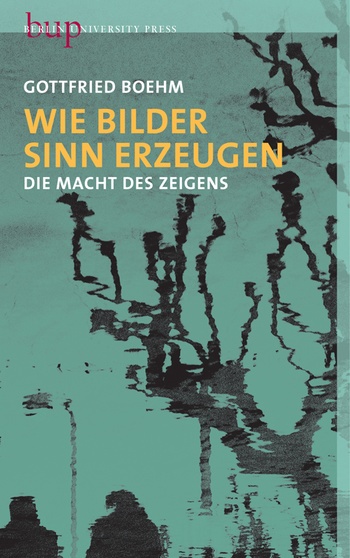Kulturbuch | Tilo Köhler: »Seht wie wir gewachsen sind«
Nach Josef Stalin wurden in den Jahren nach 1945 im sowjetischen Einflussbereich zahlreiche Objekte benannt, Straßen und Plätze, Fabriken und ganze Städte – nur die Umbenennung von Bergen blieb der UdSSR selbst vorbehalten (und Kanada). Der Name Stalins kann also durchaus für die ersten Jahre des sozialistischen Aufbaus in Ost-Europa stehen, bevor nach 1956 »der weise Führer des Weltproletariats« langsam aus dem öffentlichen Gedächtnis getilgt wurde. So kurios man das heute finden mag, Tilo Köhler hat seine Kulturgeschichte der frühen DDR ›Seht wie wir gewachsen sind‹ nicht ohne Grund an solchen Monumenten festgemacht. Von PETER BLASTENBREI
 Die »Stalin-Patenkinder«, die Köhler für die DDR ausgemacht hat, sind die Stalinallee, die heutige Karl-Marx-Allee im Osten Berlins, die Stalinwerke, die 1950 unter dem Namen Eisenhüttenkombinat Ost nahe der Oder gegründet wurden, und Stalinstadt, das heutige Eisenhüttenstadt, das als Wohnstadt für die Stahlwerker um die Stalinwerke herum konzipiert war – eine an sich durchaus sinnvolle Liste.
Die »Stalin-Patenkinder«, die Köhler für die DDR ausgemacht hat, sind die Stalinallee, die heutige Karl-Marx-Allee im Osten Berlins, die Stalinwerke, die 1950 unter dem Namen Eisenhüttenkombinat Ost nahe der Oder gegründet wurden, und Stalinstadt, das heutige Eisenhüttenstadt, das als Wohnstadt für die Stahlwerker um die Stalinwerke herum konzipiert war – eine an sich durchaus sinnvolle Liste.
Alle drei Projekte waren zu ihrer Zeit Mammutaufgaben, die die junge Republik politisch, ideologisch und wirtschaftlich-finanziell jahrelang in Atem hielten. Sie kosteten viel, sie beschäftigten viele Menschen und spielten eine zentrale Rolle in der Selbstdarstellung der frühen DDR. In der Stalinallee etwa sollten »Paläste für Arbeiter« entstehen. Und das war nicht einmal zu viel versprochen, denn die von Architekturgrößen der Moderne entworfenen Häuser waren – sensationell für die Zeit – durchgängig mit Aufzügen, Müllschluckern und matt glänzenden Kachelfassaden ausgestattet.
Jeder der aus der ganzen DDR herangeholten Helfer erwarb durch seine Arbeit das Recht auf eine solche Traumwohnung (die letzten Veteranen des Aufbaus leben hochbetagt noch heute in der Karl-Marx-Allee). Die Stalinwerke waren als Kern eines künftigen internationalistischen Ruhrgebiets des deutschen Ostens gedacht, wo aus sowjetischem Eisen und polnischer Steinkohle deutscher Stahl entstehen sollte. Stalinstadt schließlich war als erste sozialistische Stadt auf deutschem Boden geplant mit rationaler Straßenführung, leicht erreichbaren Einkaufsmöglichkeiten und großzügigen Kultureinrichtungen – bezeichnenderweise ohne Kirche (deren Bau blieb 1978 Honecker vorbehalten).
Prestige und Notwendigkeit
Man ist heute leicht geneigt, solchen Megaprojekten pauschal jeden Sinn abzusprechen, außer eben ihrer Funktion für die Eigendarstellung eines ohnehin gescheiterten Staates. Sozialistische Fehlplanung gepaart mit stalinistischem Größenwahn, kennt man ja. Besonders einfach ist das bei der Stalinallee, wo trotz aller freiwilligen Arbeitsleistungen die Bauten so immens teuer kamen, dass nirgends in der DDR eine zweite Stalinallee entstand. »Paläste für Arbeiter« waren in Serie nicht finanzierbar.
Man darf darüber nicht aus dem Gedächtnis verlieren, dass alle drei Großprojekte nicht aus Prestigedenken entstanden, sondern auf sehr reale Notlagen der Zeit antworteten. Wohnungsnot war um 1950 das brennendste Problem überall in Deutschland, besonders aber im stark kriegszerstörten Ost-Berlin. Und die Schwerindustrie war damals die Basis für jeden wirtschaftlichen Aufbau – ohne sie hätte man die Idee einer neuen Gesellschaft im industriearmen deutschen Osten gleich begraben können. Und man sollte nicht vergessen, dass hier in Ansätzen einige der revolutionären städtebaulichen Ideen der architektonischen Moderne umgesetzt wurden.
Wie schreibt man heute sinnvoll über solche symbolbelasteten Denkmäler? Wie stellt man die Kultur einer vergangenen, längst fremd gewordenen Zeit dar, für die sie exemplarisch stehen sollen, und wie geht man mit einer in Ost und West bis zum Ekel überholten Aufbaueuphorie um? Und zwar sachlich, fair und informativ, ohne billigen Jux und Besserwisserei aus heutiger Sicht?
Gebrauchslyrik
Der Autor hat das jedenfalls nicht geschafft. Köhler kleidet seine Darstellung in die Form einer dreihundertseitigen Dauerconference, forciert humoristisch, stilistisch irgendwo zwischen Ironie, Albernheit und Häme, sprachlich zwischen verunglückten Metaphern und faden Alliterationen (»nudelige Nudisten«). Mehr als einmal streift der mit Assoziationen überladene Text die Grenze der Verständlichkeit, besonders da, wo Köhlers Bandwurmsätze die Länge einer halben Seite erreichen.
Lohnt sich denn wirklich noch eine Auseinandersetzung mit Gebrauchslyrik von Johannes R. Becher und dem längst vergessenen Hans Marchwitza – oder gar mit den zahllosen über den Text verstreuten Gedichtzeilen und Liedfetzen aus den fernen 50er Jahren? Der gelernte Germanist Köhler scheint das zu glauben. Kurzweilig, wie der Untertitel verspricht, ist das nicht, wohl aber öfter einmal unfreiwillig komisch.
Doch vielleicht erklärt sich alles ja ganz einfach. Das Buch ist eine offenbar unveränderte Neuauflage von drei 1993 bis 1995 im Transit-Verlag erschienenen Einzelbänden, geschrieben also unter dem frischen Eindruck der Implosion der DDR. Damals, vor 20 Jahren, hatten nationale Einheit, Mehrparteiensystem und harte West-Mark noch nichts von ihrer Strahlkraft verloren. Und das war deshalb nicht der Moment für eine ernsthafte und eben dadurch kurzweilige Auseinandersetzung mit dem untergegangenen System.
Titelangaben
Tilo Köhler: »Seht wie wir gewachsen sind«
Eine kurzweilige Kulturgeschichte der DDR
Berlin: Bild und Heimat 2015
304 Seiten. 14,99 Euro