In seinem Sachbuch ›Vampire‹ weiß Gunther Reinhardt davon zu berichten, dass in den Jahren 1732/33 zumindest zwölf Bücher und vier Dissertationen zum Thema »Vampirismus« verfasst worden sind. Und zwar nicht wie heute als Schauermärchen, sondern durchaus ernst gemeint. Pünktlich zu Halloween hat sich BASTIAN BUCHTALECK über die Blutsauger informiert.
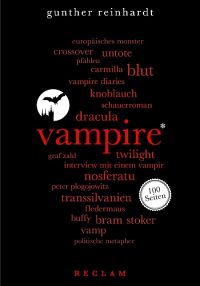 Vampire waren demnach für die Menschen im späten Mittelalter so real, wie es für manche Jugendliche heute noch das Gläserrücken ist. Eigentlich ist es Unding! Aber warum sollte es darum nicht auch wahr sein?
Vampire waren demnach für die Menschen im späten Mittelalter so real, wie es für manche Jugendliche heute noch das Gläserrücken ist. Eigentlich ist es Unding! Aber warum sollte es darum nicht auch wahr sein?
Das Sachbuch, das in der jungen Reihe ›Reclam – 100 Seiten‹ erschienen ist, versammelt auf exakt 100 Seiten, was es zum Thema Vampire zu wissen gibt. Es leitet mit einer Definition ein, erläutert anschließend den geschichtlichen Hintergrund, bevor es Literatur, Film und Popkultur um dieses sehr vielfältige, blutsaugende Wesen aufrollt.
Der vage Vampir
Die Definition einer Sache kann auf zwei Weisen erfolgen: Entweder man schildert sie in ihrem Kern und beschreibt anschließend die Ausnahmen, die sich um diesen Kern lagern. Oder man fasst die Definition so weit, dass alle Ausnahmen Teil der Definition werden. Leider hat sich Reinhardt für die zweite Variante entschieden. Er macht viele Ausnahmen zur Regel. Vom blutsaugenden Monster über aristokratische Fast-Dandys bis hin zu Posterboy-Teenagern, die sogar im Sonnenschein laufen können – alles kann Vampir sein (z.b. ›Twilight‹, ›Vampire Academy‹, ›Vampyr‹). Indem der Vampir fast alles sein kann, ist er zugleich nichts. Statt zu schärfen, verwässert der Autor die vermeintliche Wesensart des Vampirs.
Dabei ist der Vampir als Erzähltyp ziemlich trennscharf im 18. Jahrhundert entstanden. »Als unheimlicher Wiedergänger, diabolischer Antiheld, als gequälte Seele und personifiziertes Verlangen« ist der Vampir »in der Romantik allgegenwärtig«. Gemeint ist hier die Schauerromantik, die sich mit dem Tod, dem Übersinnlichen und den dunklen Seiten des Menschen auseinandersetzte. Aus dieser geht auch Bram Stokers ›Dracula‹ (1897) hervor, der den Vampir als Größe der Erzählkultur schließlich fest etabliert. Es hätte sich angeboten, von dieser Definition auszugehen.
Mit der Entstehung des Kinos erfährt das Vampirbild eine Wandlung. »Bela Lugosi stellt all das dar, was heute noch als Dracula-typisch gilt: Eleganz, Fremdartigkeit, Aristokratie, Gefährlichkeit, Dämonie.« All diese neuen Eigenschaften werden durch das Kino als visuelles Medium gefördert, diese neueren Eigenschaften kann man nämlich besonders gut sehen.
Anschließend dauerte es wieder zwei, drei Generationen, bis mit den modernsten Bewegtbildern widersprüchlichere Vampirbilder entstanden sind. Einmal geht es häufig ausschließlich um Sex und Macht (z.B. ›True Blood‹, ›Ultraviolet‹, ›Dracula Untold‹) und ein anderes Mal um Friedfertigkeit und Selbstbeschränkung (z.B. ›Twilight‹, ›Vampire Academy‹). Doch von diesem aktuellsten Wandel steht in dem Buch nichts geschrieben.
Der Vampir als gesellschaftliche Metapher
Es ist offensichtlich, dass sich das Vampirbild mit der Zeit wandelt und naheliegend, dass die jeweilige Darstellung dieser Schauer- und Horrorfiguren viel über die Gesellschaft erzählt, der sie entstammen.
So erzählen die modernsten (postmodernsten) Vampire davon, dass Sexualität heute viel freier ausgelebt werden kann und dies auch nicht als innige, ineinander aufgehende Zweisamkeit, sondern als schlichte körperliche Attraktion. Anders herum gibt es auch sehr enthaltsame Vampire. Es fällt nicht schwer hierin den Gegensatz zwischen den Ausschweifungen des Spring Break auf der einen und der Purity-Bewegung auf der anderen Seite zu erkennen.
Ähnliches gilt für das Machtstreben. Einige Vampire streben nach Macht als Selbstzweck und nicht etwa, weil sie hehre Ziele oder auch nur ein politisches Programm verfolgen. Macht an sich verschafft schon Lust. Zumindest die Parallele zu unterdrückenden Herrschern oder auch ignoranten Politikern (damit ist explizit nicht nur Donald Trump gemeint) liegt nahe. Das Sprichwort, »jemanden bis auf´s Blut ausnehmen«, könnte dort Anwendung finden.
Und es gibt Vampire, die Verzicht üben, die lieber für sich leben wollen. Sie trinken Blutkonserven oder Tierblut. Sie könnten als mahnende Vorbilder die heimlichen Lieblinge einer vegetarisch-veganen Ökobewegung sein. So wie der Vampir dem Menschen schadet, wenn er sich von dessen Blut ernährt, so schadet der Mensch der Erde, indem er sich von ihr ernährt.
Schreibweise – gewollt locker, gewollt lustig
»All jenen, die lieber endlich Blut spritzen sehen wollen, empfehle ich, zum nächsten Kapitel vorzublättern.« Verfasst ist das Buch in einem locker-lässigen Ton, der sich stellenweise etwas gezwungen lustig liest. Auch wenn es offensichtlich einen Markt für Sachbücher gibt, die in diesem Tonfall geschrieben sind, war Reclam bislang jedenfalls nicht bekannt dafür. Im Mindesten kommt dieser wenig sachliche Schreibstil unerwartet und wenig angemessen.
Daneben ist der Stil eher journalistisch ausartend als wissenschaftlich exakt: »Es ist aber auch ein Akt der Verschlingung, Aneignung, Eroberung. Der Biss ist, seit der Vampir zur literarischen Figur wurde, sexuell kodiert, als Akt der Ausschweifung, der Gewalt, der Befreiung«.  Diese aufzählende Form der dreifachen Wiederholung des Ähnlichen schmeichelt sich dem Ohr an, wirkt aber auch wenig präzise. Ein wenig mehr Fokussierung, Ernsthaftigkeit und damit einhergehend Präzision wäre wünschenswert gewesen.
Diese aufzählende Form der dreifachen Wiederholung des Ähnlichen schmeichelt sich dem Ohr an, wirkt aber auch wenig präzise. Ein wenig mehr Fokussierung, Ernsthaftigkeit und damit einhergehend Präzision wäre wünschenswert gewesen.
Zuletzt werden die Inhalte weitgehend sinnvoll und kenntnisreich komprimiert, aber auch schlicht aufzählend dargeboten. Zuerst war dies, dann folgte jenes und dann kam das, mehr wie eine Chronik und weniger wie ein analytischer Essay. Das Buch ist zwar sachkundig, aber uninspiriert geschrieben.
Die Reihe ›Reclam – 100 Seiten‹
Überhaupt widmen sich die Bücher der Reihe ›Reclam – 100 Seiten‹ in kurzer, aber nicht zu knapper Form speziellen Themen aus verschiedenen Bereichen. Ob ›Deutsche Sprache‹, ›Karl Marx‹ und ›Sex‹ oder ›Vampire‹, ›1968‹, ›Twin Peaks‹ und ›Superhelden‹ – es werden sowohl klassische als auch popkulturelle Themen aufgegriffen. Passenderweise sind die Autoren mutmaßlich dazu angewiesen, subjektiv und in lockerem Sprachstil zu schreiben. ›Vampir‹ ist hierbei weniger seriöse Wochenzeitung und mehr Jugendzeitschrift mit Starschnitt.
Fazit
Insgesamt verlangt Reclam für die genau 100 Seiten des Sachbuchs ›Vampire‹ genau 10 Euro. Ausgeben sollte das Geld nur, wer sich wirklich für das Thema interessiert und gleichzeitig nicht zu viel darüber gelesen hat. So ist das Sachbuch korrekt und befriedigend dimensioniert, jedoch wenig interessant dargestellt.
Durch die Beschränkung auf 100 Seiten fehlt die inhaltliche Tiefe, zumal es ein eher kleineres und schmales Taschenbuchformat ist. Darüber hinaus sollte man sich genau überlegen, ob man für die betont lustige, gewollt lockere und stellenweise wenig inspirierte Schreibweise bereit ist.
| BASTIAN BUCHTALECK
| Bild: Lizenz Freie Kunst 1.1
Titelangaben
Gunther Reinhardt: Vampire
Serie Reclam 100 Seiten
Stuttgart: Reclam 2018
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe





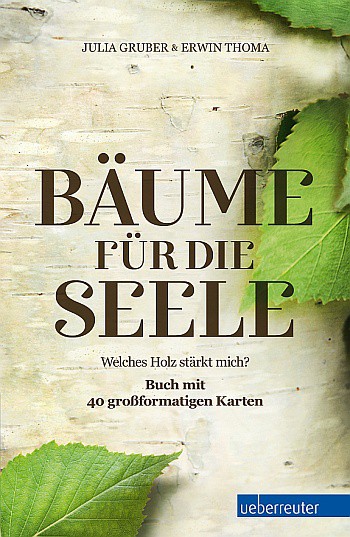

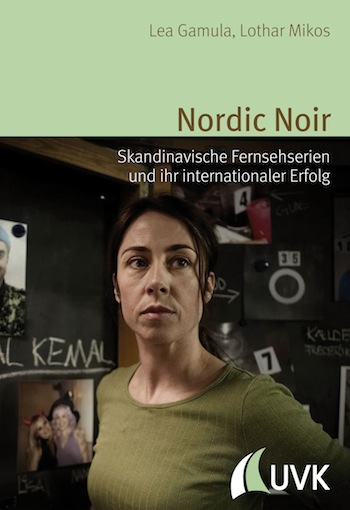

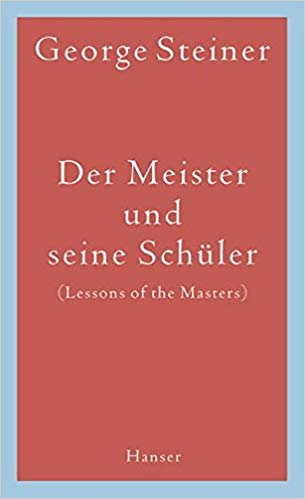
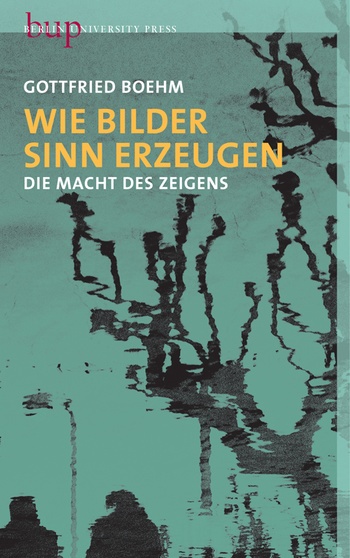
[…] […]