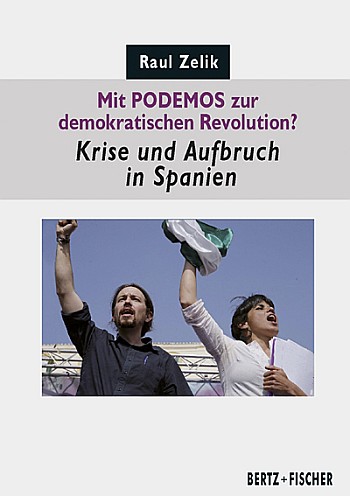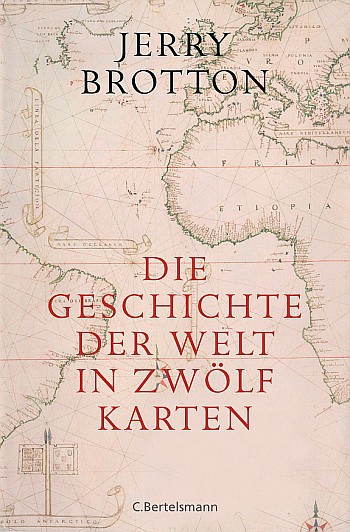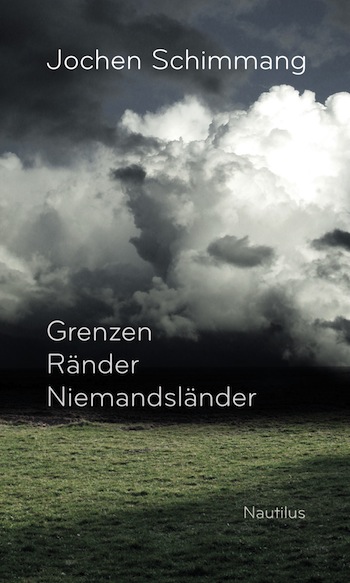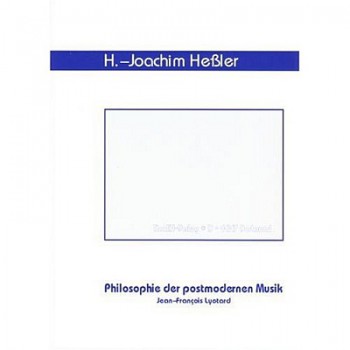Kulturbuch | Matthias Politycki: 42,195. Warum wir Marathon laufen und was wir dabei denken
Wer schon einmal einen Marathon gelaufen ist, weiß, welche Gefühlsachterbahnen über die geschichtsträchtige Streckenlänge von 42,195 Kilometern entstehen und welche Glückshormone im Zielbereich ausgeschüttet werden. Zugleich ist es für das Umfeld von »Marathonis« bisweilen unverständlich, warum ein solch zeitlicher Aufwand, bisweilen monotone Trainingseinheiten und das nicht endend wollende Leiden ab Kilometer 30, wo der in der Läuferszene berüchtigte »Mann mit dem Hammer« wartet, Anreize sein sollen, um einen Marathon zu absolvieren. Matthias Politycki schreibt in ›42,195. Warum wir Marathon laufen und was wir dabei denken‹ über seine Erfahrungen auf der Königsstrecke des Laufsports TOBIAS KISLING hat das Buch gelesen
 Matthias Politycki versucht in seinem Buch dieses Unverständnis zu revidieren und erzählt über seine eigenen Erfahrungen, die er in seinem Läuferleben sammeln durfte. Für Politycki stellt das Werk ein Genrewechsel dar. Bisher war er vor allem mit Romanen, Essays, Gedichten und Erzählungen auf dem deutschen Buchmarkt präsent. Mit 42,195 wagt Politycki den Spagat, ein Buch über das Laufen mit autobiographischen Bezügen aus seinem Schriftstellerleben zu verbinden. Über das Resultat lässt sich streiten.
Matthias Politycki versucht in seinem Buch dieses Unverständnis zu revidieren und erzählt über seine eigenen Erfahrungen, die er in seinem Läuferleben sammeln durfte. Für Politycki stellt das Werk ein Genrewechsel dar. Bisher war er vor allem mit Romanen, Essays, Gedichten und Erzählungen auf dem deutschen Buchmarkt präsent. Mit 42,195 wagt Politycki den Spagat, ein Buch über das Laufen mit autobiographischen Bezügen aus seinem Schriftstellerleben zu verbinden. Über das Resultat lässt sich streiten.
Wer den trockenen Läuferhumor eines Hajo Schumachers, alias Achim Achilles, oder Marc Bischoffs erwartet, wird enttäuscht. Politycki möchte nicht den schmunzelnden Blick auf die eingeschworene Läufergemeinschaft werfen, ihm geht es um eine seriöse und bisweilen nachdenklich stimmende Erzählung seiner Erfahrungen. Themen wie die Anschläge beim Boston-Marathon 2013 oder eine kritische Auseinandersetzung mit dem Ernährungshype symbolisieren die Ernsthaftigkeit, die hinter 42,195 steht. Einen Meilenstein wie Christopher McDougall wird Politycki mit seinen als 45,195 Kapiteln (eins für jeden Kilometer sowie Startbereich, Halbzeit, Ziel und Zieleinlau) aber wohl kaum setzten können. Dafür fehlt die Tiefe. Themen werden systematisch abgearbeitet, oft mit wenig begründeten Thesen fragwürdige Sachverhalte hergestellt. Ungeeignet ist das Marathon-Buch für Läufer, die nach der Geheimzutat suchen, um ihre Zeiten zu verbessern. 42,195 hat nicht den Anspruch, ein Trainingsratgeber zu sein. Im Gegenteil: Sportwissenschaftlich ist das Buch wenig empfehlenswert, auch weil Politycki die Kompetenz zum eigenen Erstellen eines Trainingsplans fehlt, wie er offen zugibt.
Fraglich bleibt, wen Politycki als Zielgruppe im Blick hat. Läufer, die den Marathon unter drei Stunden zurücklegen, gelten für ihn als »Elite« mit gering ausgeprägten »sozialen Leben«. Läufer, die in Verkleidung an den Start gehen, sind für ihn »Clowns« und Läufer, die sich nach dem Start unsanft vorbeidrängeln, gehören mit dem »Ellenbogen« bearbeitet.
So bleibt bei leidenschaftlichen Läufern an vielen Stellen des Buches nur ein Kopfschütteln, insbesondere wenn Politycki sich selbst den Spiegel vorhält und über seine Erfolge der Ausdauer beim Schreiben und beim Laufen berichtet. Der wohnhafte Hamburger/Münchener mag damit für sein Selbstbewusstsein werben, für den Leser fällt der Grat zur Arroganz schmal aus.
Politycki wollte sein Werk bewusst nüchtern schreiben. Nur selten blitzt sein literarisches Talent auf und sorgt für eine willkommene Abwechslung auf den Kilometern, die auch beim Lesen des Buches einiges an Ausdauer abverlangen.
Etwas unpassend erscheinen seine Ausflüchte weg von der ansonsten so politisch korrekten Schreibweise. Wenn ein »Scheißkerl« im Rennen beschimpft wird oder Frauen im nicht unüblichen rauen Lauftreff-Ton beschrieben werden (»Was bei Männern ein Gen ist, ist bei ihnen ein Defizit«), so stößt dies auf Irritation und Unverständnis.
Positiv fallen die Wortbeiträge von Polityckis Trainingskollegen auf, die immer wieder in den Kapiteln Beachtung finden und für frischen Wind im Trott des Marathons sorgen. Für Nicht-Läufer hilfreich sind zudem die Fußnoten, die das gängige Läuferjargon erklären und eine Brücke zwischen Sportlern und Nichtsportlern in der Leserschaft schlagen. Wie bei einem Marathon so wird auch die Ausdauer des Lesens von 42,195 im Zielbereich belohnt. Statt der Medaille gibt es zum Abschluss ein philosophisches Kapitel über die Perspektiven des Laufsports für die Gesellschaft. Immerhin. Und doch bleibt wie bei jeder Organisation eines Marathons die Erkenntnis, dass es für die Etablierung im Rennkalender der Läufer mehr braucht, als nur einen guten Zielbereich, um langfristig nicht in eine Sackgasse zu laufen.
| TOBIAS KISLING
Titelangaben
Matthias Politycki: Warum wir Marathon laufen und was wir dabei denken
Hamburg: Hoffmann und Campe 2015
320 Seiten, 20,00 Euro
Erwerben Sie dieses Buch bei Osiander