Musik | Ottar Gadeholt über die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil I)
»You know where you are? You’re in the jungle, baby. You’re gonna diiiieeeeeee.«
Zwar sind sie in manchen Kreisen immer noch populär, ich kenne aber keine Rockband, über die so viel gelästert wird wie über Guns N’Roses. U2 könnte man vielleicht aufzählen, oder Coldplay; es ist aber in der Regel nicht die Band U2, über die man sich aufregt, es sind eher PR-Geilheit, Selbstgerechtigkeit und Heuchelei, die Eiter und Galle hervorrufen. OTTAR GADEHOLT nähert sich dem Rockphänomen Guns N’Roses. Im ersten Teil geht es um die Frage, wo sich GN’R im Musikdschungel verorten lassen.

Abb: Rock2282
Streng genommen sollten alle, die Rock mögen, auch an Guns Freude finden: ›It’s so easy, Out ta get me und Shotgun blues‹ sind dreckige, paranoide Punksongs; ›Nighttrain, You could be mine‹ und ›Locomotive‹ Hardrock zum Vorglühen mit den Jungs; ›Dust’n’Bones‹, ›Bad Obsession‹ und die halbakustische Version von ›You’re Crazy‹ sollten die ansprechen, die Stones-artigen Bluesrock präferieren, und für die, die grandioses Tongewebe, Prunk und Pracht mögen, hat man ›Estranged‹, ›Breakdown‹ und der Pfau – oder ist es ein Truthahn? – ›November Rain‹.
Argumente gegen die Band gibt es viele und vielfältige: »Memmen!«, heißt es von denen, die noch schwerere und härtere Musik mögen. »Ich mag die Stimme nicht«, sagen Bon-Jovi-Fans. Frauenfeindlich«, sagen die Vernünftigen, und die noch vernünftigeren vertiefen: »[Sänger] Axl Rose spinnt total«. Ich habe andere Argumente auch gehört; manche drücken Geschmack und Präferenz aus, während andere eher Werturteile sind, sie haben alle gemeinsam, dass sie keine ausreichende Erklärung bieten für die zeitweise auffällig emotionale Missbilligung. Es herrscht kein Zweifel, dass die Band sich nicht gerade vorbildlich benahm, weder im Studio, auf der Bühne noch privat, diesbezüglich unterscheiden sie sich aber nicht essenziell von der Mehrheit der berühmtesten Rockmusiker der Welt.
Es kann natürlich sein, dass es sich nicht um generelle Betrachtungen handelt, sondern um konkrete, inakzeptable Äußerungen, aber auch dazu: ›One in a Million‹, der Song in dem Rose seinen Hass auf Schwule und Einwanderer hinausschleudert, ist sicherlich indiskutabel, es gibt aber nicht viele – zumindest nicht unter denen, die sich genuin für Popmusik interessieren – die Public Enemy hassen, weil Professor Griff Juden angriff, oder Gangsta Rap, weil dieses Genre frauenfeindlich und homophob sei. Geschweige denn, dass Kari Rueslåtten und Sigurd Wongraven immer noch im norwegischen Musikmilieu weiterhin gern gesehen sind, obwohl sie (mit der Band Storm) sangen: »Wir sind norwegisch und stolz darauf/ die Christenhunde wollen wir nicht sehen/ auf dem Berge« [eigene Übersetzung des Verf.]. Somit ist es nicht glaubwürdig, dass es die konkreten Aussagen von GN’R sind, die die Wut hervorrufen. Es ist nicht damit gesagt, dass man den Song ›One in a Million‹ verteidigen sollte, nicht einmal, dass man es kann, oder Axl Rose selbst, meinetwegen; es ist aber möglich, dass man klüger wird, wenn man die Band näher betrachtet, die den Song geschrieben hat.
»Weinende Stadttaube, Stones-Kopie oder nur eine von Tausend Haarmetalbands?«
Anstatt anekdotische Meinungsäußerungen von Leuten zu diskutieren, die (vielleicht) nicht einmal Musik mögen, oder zumindest nicht solche Musik, könnte es mitunter nützlich sein zu schauen, was Fachjournalisten über die Band gesagt haben. Der Hardrockautor Essi Berelian schreibt in der ›Rough Guide to Rock‹: »derivative but frighteningly good«, und das scheint mir eine faire Beschreibung über das Debüt-Album ›Appetite for destruction‹. Audun Vinger, wahrscheinlich der beste Musikkritiker Norwegens, schrieb ein Artikel über die ›Use your Illusion‹-Alben in der Zeitschrift ›ENO‹, der Artikel ist aber merkwürdig zurückhaltend in seiner Sprachführung und seinem Urteil, er behandelt dazu in auffälligem Ausmaß weniger die Musik als diverse Paraphernalien und persönliche Assoziationen (er schreibt sieben Abschnitte, bevor er überhaupt einen einzigen Song von den Alben bespricht, vergleicht die Band mit einer weinenden Stadttaube(!) und outet sich als Fan von Christen-Psychedelia aus den 70ern (!!!)) Das interessanteste Textstück aber, das ich über GN’R gefunden habe, und das nahezu komplett zitiert werden sollte, ist das folgende:
When [Guns N’Roses] released their debut album, Appetite for Destruction, in 1987, they were just one of a hundred identikit LA bands with lion manes, loud guitars and bicep artwork courtesy of Sunset Strip Tattoo. Only when the torrid tales of overdoses and detox centres started filtering through to the world at large did Appetite begin creeping up on the charts. The fact that the record was a thoroughly ordinary collection of hard rock/metal songs did not unduly trouble punters thirsting for a little vicarious debauchery.
As with [Mötley] Crüe, Guns were merely a Xerox of a Xerox of a Xerox: the 1969 Stones via Aerosmith via Hanoi Rocks. [the lead guitarist Slash said:] ›there’s a bunch of us still clinging fast to the late sixties and early seventies.‹ ‚Clinging was about the sum of it, however abjectly the world’s media colluded with the age-old Sunset Strip pose. Lead singer Axl Rose was the archetypal messed-up smalltown boy, come to Hollywood to reinvent himself as a junkie rock god, and the others weren’t a lot more prepossessing.
The incredible thing about the Sunset Strip metal and hard-rock scene is simply that all those poodle haircut/Harley Davidson/skull-and-crossbones-tattoo clichés refuse to die. Year in, year out, one sees the same imbeciles unloading their Marshall stacks into crappy pay-to-play dives like the Coconut Teaszer or gawping at pink Ibanez axes in the Guitar center. Boys in leather pants and mirror shades still swarm into Hollywood to hang out at the Rainbow bar, all of them hoping against hope that their minor variation on a dead theme is going to propel them into the stadiums. The casualties among those chasing the Guns N’Roses fantasy – no-hope bands living in squalid cubicles like those in the ‚Billiards‘ building on Hollywood and Western – are endless.
[…]
One man who’d seen it all before was [LA music mogul] Lou Adler, for whom many of the bands trooping in and out of the Roxy were (and are) simply ‚imitating a rock’n’roll lifestyle‘. ‚They all know the script‘ he adds, ‚and they’re following the line that’s been laid down for them.
Almost as incredible as the endless recycling of the clichés is that the same breed of groupies and caretakers continues to come to the aid of these dorks, feeding them, fellating them and procuring the requisite pharmaceuticals for their bad-boy hairstyles. […]
Mit dem Beil zermetzelt
Das Bemerkenswerte an diesem Text ist nicht, dass er die Band mit Beil zermetzelt, wie die Engländer sagen, ein richtiger hatchet job, sondern der Stil, in dem es getan wird. Ich denke, dass jeder gute Kritiker imstande ist, ein vernichtendes Urteil zu fällen, und ich vermute, dass viele von ihnen Ausdrücke und Formulierungen sammeln, die dafür geeignet sind (mein Liebling ist von einer Rezension von Ralph Myers and the Jack Herren Band in der norwegischen Gratiszeitung ›Natt og Dag‹: »dies ist keine Musik aus der Hölle, sondern aus dem Aufzug auf dem Weg dahin«), eine Metzelei muss mit Humor, Arroganz und sprachlichem Überschuss gemacht werden, und diese Stilmittel sind in dem oben zitierten Artikel abwesend.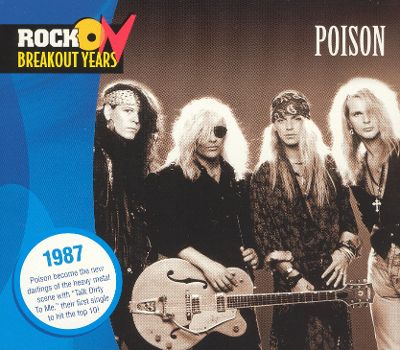
Der Ansatz ist pampig, nicht zu sagen kleinlich: »Die Band ist nur eine unter vielen«, »die Songs sind ordinär«, »sie waren erst erfolgreich, als die Medien von ihrem Drogenkonsum gehört hatten«, »die Band ist nur eine schlechte Stones-Kopie« etc. pp. Zusätzlich scheint die Sorge um die, die von der Band inspiriert wurden, geheuchelt: Es gibt zweifellos zahllose dumme Jungs, die nach LA fahren, um GN’R zu kopieren, und dabei zugrunde gehen, und dumme Mädchen von der gleichen Sorte, die ihnen Geld geben und mit ihnen schlafen gibt es sicher auch reichlich, es scheint aber etwas unfair, Guns N’Roses dafür zu kritisieren.
Dazu ist eine der Prämissen für den Text geradezu falsch: ›Appetite‹ wurde nicht zum Riesenerfolg, weil man über die Ausschweifungen der Band las; es ist undenkbar, dass 18 Millionen Menschen Geld zahlen, weil eine Band Schnaps trinkt und raucht und Heroin spritzt, genauso wie die Beatles nicht unzählige Platten verkauften, weil sie ungewöhnliche Frisuren hatten; ›Appetite‹ kletterte die Verkaufslisten hoch, weil ›Sweet Child o’mine‹, eine hübsche, aber etwas lang geratene Hardrockballade mit spektakulären Gitarrenpartien, an der Spitze der Single-Charts stand (Guns war die erste Rockband seit Jahren, die sowohl die Singles- als auch die Albumcharts anführten).
Der Rest des ersten Absatzes hält auch nicht Stand: Jeder, der Guns mit Poison or Mötley Crüe verglichen hat, geschweige denn mit den anderen Hartmetallbands aus LA in den frühen Achtzigern, Bands, die längst vergessen sind, hört den Unterschied: Erstens haben die zwei letzteren und ihre Nachahmer einen ganz anderen Sound: der helle, scharfe Ton der Achtziger-Jahre-»Superstrats« – rosarote Ibanez-Gitarren, wenn man will – mit künstlichen Flageoletten und dem Divebomb-Effekt, den man mit den Floyd-Rose-Vibratoarm hervorrufen kann; ein reines, metallisch klingendes Lautbild, in dem beide Gitarren dasselbe, straighte Riff spielen und die Gitarrensoli klingen, als wäre das Ziel die höchste Anzahl an Töne in die kürzeste mögliche Zeit zu quetschen. Es klingt, als hätte man Iron Maiden mit van Halen vermischt und eine dicke Schicht Haarspray draufgesprüht.
Kalifornien: mehr als Partys, Motorräder und Scharen von Groupies
Abb: AJ Kashmir
Der nächste Unterschied zwischen GN’R und den oben genannten Bands, ein Unterschied, der streng genommen noch wichtiger ist als der akustische, ist die Thematik. Mötley Crüe lässt immer wieder Songs damit beginnen, dass eine Harley Gas gibt; sie orientieren hin sich zu Party, Weibern, schnellen Autos, einfachen Metaphern (›Kickstart my heart…‹) oder generischen Teufelsphantasien, während Poison dazu noch romantisierende Geschichten von jungen Mädchen in der Großstadt erzählen (›Fallen Angel‹) und stellen schleimige Anmachsprüche vor (›Sexual Thing‹). Diese Motive können in einem Begriff zusammengefasst werden: Kalifornien; näher gesagt Los Angeles.
Sowohl Poison als auch Crüe verdienten ein Schweinegeld und sicherten sich dekadente Partys, fette Motorräder und Scharen von Groupies, in dem sie über dekadente Partys, fette Motorräder und Scharen von Groupies sangen; dieser Trick wurde früher von den Eagles bedient (die Vorstellung von einer halb-halb-Mischung von Eagles und Judas Priest wirkt beim ersten Hinschauen absurd, ist aber eine gute Beschreibung von Mötley Crüe). Gleichzeitig ist es ein wesentlicher Punkt, dass die Songs dieser Bands sich auf einer allgemeinen, fast abstrakten Ebene befinden, ohne konkrete Referenzen an die Wirklichkeit. Keiner dieser Songs besitzt eine autorielle Figur, die die Welt um sich herum beobachtet, es ist auch nicht möglich, sich eine solche Figur vorzustellen (so wie sich Greil Marcus in ›Mystery Train‹ vorstellt, dass alle Songs auf den zwei ersten Alben von the Band von derselben Person entweder beobachtet oder erlebt werden).
Guns N’Roses kommen aus einem ganz anderen Ausgangspunkt, einem, der am besten von dem Song illustriert wird, der meines Erachtens ihr allerbester ist, ein Song, der den Unterschied zu anderen Haarmetalbands deutlich zeigt. Es ist der erste Song auf dem ersten Album, ein Song, der sich weit über die Grenzen der recht ungenauen Beschreibung »Hardrock« bewegt, und der keineswegs als ordinär bezeichnet werden kann. Der Song heißt ›Welcome to the Jungle‹.
In der nächsten Woche folgt an dieser Stelle Teil II unserer Betrachtungen zu Guns N’Roses. Darin folgt Ottar Gadeholt der Band in den Sündenpfuhl von Los Angeles und findet einen anderen Namen für die Stadt der Engel.
| OTTAR GADEHOLT
Reinschauen
| Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil I)
| Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil II)
| Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil III)
| Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil IV)
| Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil V)




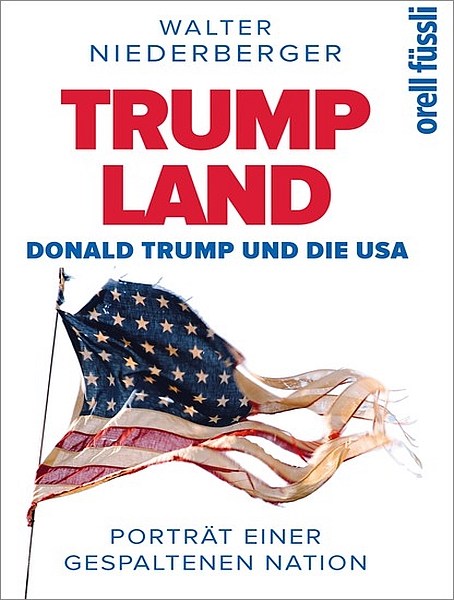






[…] | Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil I) | Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil II) | Die mythologische Seite von Guns N’Roses […]
[…] | Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil I) | Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil II) | Die mythologische Seite von Guns N’Roses […]
[…] | Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil I) | Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil II) | Die mythologische Seite von Guns N’Roses […]