Musik | Ottar Gadeholt über die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil V)
Was ist dann aber passiert? Wie konnte Guns N’Roses, die bei Weitem größte und erfolgreichste Rockband der späten Achtziger, als eine etwas peinliche Parenthese der Musik in der Öffentlichkeit enden, während weit weniger interessante Bands – wie AC/DC oder Kiss – einen unangreifbaren Kultstatus erreicht haben und in den Feuilletons der großen Zeitungen gepriesen werden? Von OTTAR GADEHOLT
Wie kann es sein, dass Barney Hoskyns, einer der gemäßigsten, reflektiertesten Autoren der Rockjournalistik, die Band mit einer Reihe groben Ungerechtigkeiten abwinkt?

Abb: Rock2282
Dieser lächerliche Aspekt wird erst dann manifest, wenn der Künstler oder die Band sich ernst nehmen, denn das Lächerliche tritt hervor, wenn es eine klare Diskrepanz gibt, wie ein Beobachter und ein Beobachteter eine Situation erleben. Deswegen kommen AC/DC und Kiss glimpflich davon, weil sie die ganze Zeit implizit ausdrücken, dass sie nur Quatsch machen und nichts von dem meinen, wovon sie singen oder sprechen. Guns N’Roses, andererseits, war for real und spielte ihre Rolle mit Hingabe. Es ist nicht damit gesagt, dass sie humorlos waren: der bereits genannte Pretty tied up wird mit einem zynischen Grinsen gesungen, und I used to love her ist eines der wenigen Hardrockbeispiele für einen genuinen – wenngleich auch morbiden – novelty song von der Art, wie er in der Countrymusik häufig vorkommt. Die grundlegende Haltung der Guns ist jedoch, dass das, was sie treiben, todernst ist. Von außen und zurückblickend beobachtet gibt es dabei ein Gefühl des Vergangenen, wenn nicht sogar anachronistischen, in dieser Attitüde.
Die Rockband als mythische Größe
Nachdem die Punkmusik die alte Garde der Rockmusiker weggefegt hatte; nachdem Nixons war on drugs Alltag geworden war, und nachdem AIDS ungeschützten Sex zum hochriskanten Zeitvertrieb verwandelt hatte, waren die Grundvoraussetzungen, den klassischen Rockmythos auszuleben weit schlechter als in der Zeit der Stones oder Zeppelins. Außerdem war der Rock als Ausdruck reifer geworden, weswegen die Connaisseurs auf Klischees und Muster weit aufmerksamer waren als früher. Wenn man diese Aspekte mit in Betracht zieht, ist es verständlich, dass die Rockband als mythische Größe zurückgedrängt wurde. Außerdem, und das ist vielleicht noch eine Folge der überanalytischen Annäherung des Postmodernen an die kulturellen Phänomene dieser Welt, scheint es ein durchgehendes Zeichen unserer Zeit sein, dass man schlecht weiß, wie man sich denen gegenüber verhalten soll, die ihre Sache komplett ohne Selbstreflexion und Ironie betreiben – die Ausnahme ist Sport, den scheinbar alle ernst nehmen.
Somit wird es schwierig, Texte von Metalbands oder Singer-SongwriterInnen zu hören, ohne beschämt den Kopf zu schütteln, während die, die ständig ein selbstironisches Grinsen zeigen, die die dissimulieren, gut ankommen, weil das Publikum den Spaß versteht und sich nicht durch den Ernst bedroht fühlen. Jedenfalls: der Zeitgeist war vom Anfang an gegen Guns N’Roses, und da sie auch ihr Benehmen eher nach Spinal Tap orientierten als nach disziplinierten Zeitgenossen wie Metallica, fiel es ihnen noch schwerer, nicht unzeitgemäß zu werden.
Der Todesstoß der Chucks-Träger
 Der Todesstoß für Guns N’Roses kam 1991, kurz bevor die Use your Illusion-Alben rauskamen – als die bis dahin recht unbekannte Punkband Nirvana ihre zweite Platte herausbrachte, Nevermind. Das Album wurde bei Geffen publiziert, die auch das Plattenlabel von Guns N’Roses war, und durch schwere Rotation auf MTV wurde es zum gigantischen Hit. Obwohl beide Bands Musik machten, die nicht gerade die Elterngeneration ansprach (im Gegensatz zu Bon Jovi, zum Beispiel), und obwohl beide Bands große Heroinprobleme hatten (Guns N’Roses waren angeblich clean als Nevermind rauskam, es hatte ihnen aber einen Schlagzeuger und zahllose Aufenthalte in der Betty-Ford-Klinik gekostet), gaben es riesige Unterschiede zwischen den beiden. Der erste, und das ist recht überraschend, wenn man die Platten im Nachhinein hört, ist, wie glatt Nevermind klingt, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass Nirvana mit ihren Flanellhemden, Jeans und Converse-Schuhen als bodennaher als Guns galt; Letztere gingen mit nackten Oberkörpern, Lederhosen und Boots auf die Bühne.
Der Todesstoß für Guns N’Roses kam 1991, kurz bevor die Use your Illusion-Alben rauskamen – als die bis dahin recht unbekannte Punkband Nirvana ihre zweite Platte herausbrachte, Nevermind. Das Album wurde bei Geffen publiziert, die auch das Plattenlabel von Guns N’Roses war, und durch schwere Rotation auf MTV wurde es zum gigantischen Hit. Obwohl beide Bands Musik machten, die nicht gerade die Elterngeneration ansprach (im Gegensatz zu Bon Jovi, zum Beispiel), und obwohl beide Bands große Heroinprobleme hatten (Guns N’Roses waren angeblich clean als Nevermind rauskam, es hatte ihnen aber einen Schlagzeuger und zahllose Aufenthalte in der Betty-Ford-Klinik gekostet), gaben es riesige Unterschiede zwischen den beiden. Der erste, und das ist recht überraschend, wenn man die Platten im Nachhinein hört, ist, wie glatt Nevermind klingt, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass Nirvana mit ihren Flanellhemden, Jeans und Converse-Schuhen als bodennaher als Guns galt; Letztere gingen mit nackten Oberkörpern, Lederhosen und Boots auf die Bühne.
Nevermind hat einen harten, metallischen Klang, der heutzutage viel veralteter klingt als der klassische Rock-Sound der Guns. Ferner betont Nevermind den Kontrast zwischen stillen und geräuschvollen Partien, eine Dynamik, die über ein ganzes Album durchgeführt etwas ausgelaugt erscheint. Andererseits: bei den Singles Smells like Teen Spirit und Come as You are ist sie zweifellos sehr effektiv. Nirvana ist konsequent melodischer als GN’R, die sich insbesondere auf Appetite for Destruction viel mehr gegen Rock’n’Roll und damit indirekt gegen die traditionell schwarzen Musikformen Blues, Funk und Rhythm’n’blues orientierten, diese priorisierten in der Regel Rhythmus und Groove über Melodie. Damit wird Nirvana, wie so viele Musiker des sogenannten »Alternativ-Rock«, paradoxerweise mehr Mainstream-orientiert und viel »weißer« als der klassische Rock, gegen den sie rebellierten. Gleichzeitig haben beide Bands deutliche Wurzeln in der (sehr ethnisch homogenen) Punkmusik, außer dass Guns N’Roses eine musikalische Vielseitigkeit und eine Kreativität an den Tag legen, die Nirvanas einfache Arpeggios und Powerchords um Meilen übertreffen.
Indem Nirvana nicht einmal versuchte mit konventionellen Rockmusikern in Wettstreit zu treten, toupierte Haare oder nicht, wenn es um musikalische Virtuosität ging, ist eine solche Gegenüberstellung nicht sonderlich zielführend. Spannender ist es, die Texte und die Thematik dieser beiden Bands, die beide über zwanzig Millionen(!) Scheiben verkauften, zu vergleichen:
Genau wie Welcome to the Jungle, der erste Song auf dem bestverkauften Album von Guns N’Roses, emblematisch ist für die Band, ist es Smells like Teen Spirit, der erste Track auf Nevermind, für Nirvana. Smells like Teen Spirit fängt auch mit einem zerhackten Gitarrenriff an, während aber die Kaskade von Jungle technisch anspruchsvoll ist, ist der von Teen Spirit lediglich eine simple Transposition – als solche wurde er immer wieder auf Schulfahrten und Ferienlager ausgepackt, in der Zeit in der Nirvana auf dem Gipfel war – der von einem klassischen Punk-Dreierkombi fortgeführt wird: mit solidem, einfachem Bass – und Schlagzeuger Dave Grohl mit voller Wucht.
Abb: Craig Carper
»With the lights out, it’s less dangerous/Here we are now, entertain us/I feel stupid and contagious/Here we are now, entertain us.«
Vertonte bipolare Störung
Der Unterschied zwischen dem passiv-aggressiven, antriebslosen Jammern Cobains (»here we are now, entertain us«), seiner brustschwachen, ausweichenden, wenn nicht sogar dissimulierenden Attitüde (»It’s fun to lose and to pretend«) einerseits und die Raserei und der Wunsch von Guns N’Roses, den Hörer zur Akzeptanz ihrer Weltanschauung zu zwingen, andererseits, ist fundamental und wird von der letzten Strophe von Smells like Teen Spirit unterstrichen: »And I forget just why I taste/Oh yeah, I guess it makes me smile/I found it hard, it’s hard to find/Oh well, whatever, never mind…« Es ist eine duckmäuserische, defensive Aussage, demonstrativ ziel- und sinnlos, selbst im Vergleich mit anderen Alternativ-Rockern. Um nicht missverstanden zu werden: Es ist nicht unbedingt so, dass sich eine Rockband immer ernst nehmen muss, oder dass Songtexte nur über Sex, Drogen und Rock’n’Roll gehen dürfen, aber keiner (außer selbstverliebten Teenagern) hält derart vorgejammerte Texte lange aus, und auch die werden irgendwann mal erwachsen.

Abb: Saad Faruque
Guns N’Roses waren also chancenlos, schon bevor sie ihr zweites richtiges Album herausgebracht hatte: Die Kombination von neuen Zeiten, eigenen Schwächen, steif gewordener Mythologie, und einer anderen Band, die, obwohl sie musikalisch minderwertig war, mit ihren motzigen Teenagertexten beim Publikum irgendeinen Nerv traf, war zu viel. Und immer noch, obwohl Appetite for Destruction immer eine unglaublich gute Platte ist – nach jeder längeren Pause merke ich wieder, wie frisch die Platte klingt – fällt es einem erwachsenen Mann nach der Jahrtausendwende schwer, den offensichtlichen Anachronismus von GNR zu verteidigen, deshalb ist es ein bisschen peinlich, sie immer noch zu mögen.
Peinlich, sie zu mögen …
Ich weise aber nochmal auf ein Zitat aus dem Text von Barney Hoskyns über Led Zeppelin hin: »For what you hear on Babe, I’m gonna leave you and every great Zeppelin track is not just power – amplified aggression matched by priapic swagger – but yearning, journeying, questing for an ideal.« Das gilt genauso für Guns N’Roses; in der Sehnsucht und der Reise (insbesondere in Paradise City, »where the grass is green and the girls are pretty«), und verstärkte Aggression und Schwanz-Strotzen findet man bei vielen GN’R-Songs. Das Problem ist bloß, dass man diese Sachen in der Rockmusik nicht mehr sucht.
Für die wenigen, aber, die immer noch bereit sind, jenseits der Vorstellungen zu schauen, die in der Kulturwelt unserer Zeit als du jour gelten; die, die immer noch imstande sind, was einmal als große Kunst galt, aber nicht mehr gemacht wird, unvoreingenommen über sich ergehen zu lassen; für die, die es ertragen, sich der Weltansicht einer überwältigende Persönlichkeit auszusetzen, auch wenn es bedeutet, dass man einen Kick in the Mind erleidet, ist es wohl wert, Guns N’Roses anzumachen. Zu Not verzichtet man halt darauf, davon zu erzählen.
| OTTAR GADEHOLT
| Titelbild: DAN
Reinschauen
| Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil I)
| Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil II)
| Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil III)
| Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil IV)




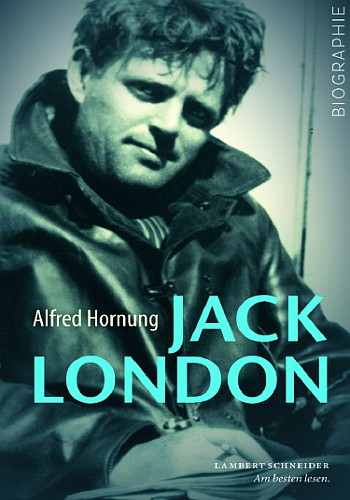


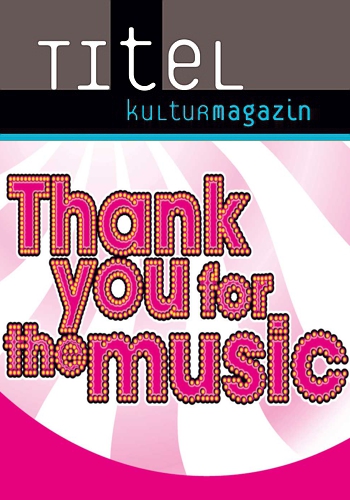

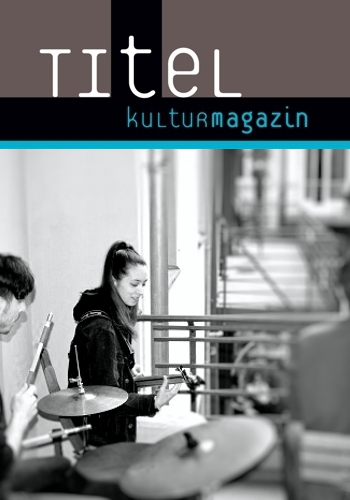
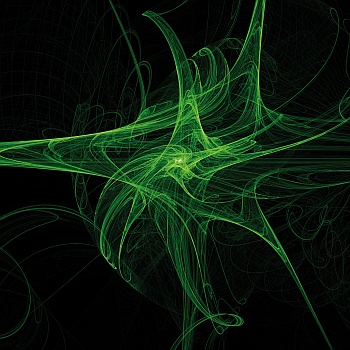
[…] Reinschauen | Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil I) | Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil II) | Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil III) | Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil IV) | Die mythologische Seite von Guns N’Roses (Teil V) […]