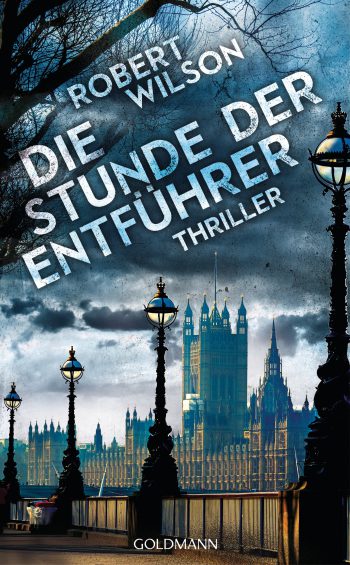Roman | Gabriel Garcia Márquez: Hundert Jahre Einsamkeit
In Deutschland wurde der kolumbianische Schriftsteller und Journalist Gabriel García Márquez mit seinem Roman Hundert Jahre Einsamkeit, der jetzt in einer Neuübersetzung vorliegt, bekannt. Aber auch andere Werke von ihm zählen zu einer allseits beliebten Lektüre. Von BETTINA GUTIÈRREZ
 Eine Erzählung, so schreibt der kolumbianische Schriftsteller Gabriel García Márquez in dem Vorwort zu seinen Zwölf Geschichten aus der Fremde (1992) habe weder einen Anfang noch ein Ende: »Sie gelingt oder sie gelingt nicht.« Dass diese Geschichten gelungen sind, kann man nach deren Lektüre zweifellos feststellen. Sie gehören zum Besten, was García Márquez je geschrieben hat. Hier legt er der literarischen Fiktion journalistische Anekdoten zugrunde und erzählt von den alltäglichen Begebenheiten, die seinen Landsleuten in Europa widerfahren, indem er das Wirkliche ins Unwirkliche und das Unwirkliche ins Wirkliche umkehrt.
Eine Erzählung, so schreibt der kolumbianische Schriftsteller Gabriel García Márquez in dem Vorwort zu seinen Zwölf Geschichten aus der Fremde (1992) habe weder einen Anfang noch ein Ende: »Sie gelingt oder sie gelingt nicht.« Dass diese Geschichten gelungen sind, kann man nach deren Lektüre zweifellos feststellen. Sie gehören zum Besten, was García Márquez je geschrieben hat. Hier legt er der literarischen Fiktion journalistische Anekdoten zugrunde und erzählt von den alltäglichen Begebenheiten, die seinen Landsleuten in Europa widerfahren, indem er das Wirkliche ins Unwirkliche und das Unwirkliche ins Wirkliche umkehrt.
Ein gestürzter lateinamerikanischer Präsident kehrt im Angesicht des Todes an seinen Studienort Genf zurück, um eine sinnlose Operation vornehmen zu lassen, die ihn, trotz des guten Rufs der Schweizer Medizin nicht von seinem Leiden befreit. Zurückgekehrt ins Exil Martinique, beschließt er, wieder für sein Land zu kandidieren. Margarito Duarte reist mit dem schwerelosen Körper seiner verstorbenen Tochter nach Rom und wartet dort zweiundzwanzig Jahre auf ihre Heiligsprechung.
Diese Abart der Frömmigkeit wird zur Karikatur seines eigenen Schicksals denn »fünf Päpste waren gestorben, das ewige Rom zeigte erste Symptome von Hinfälligkeit und er wartete noch immer«. Siebzehn Engländer sitzen im Vestibül eines neapolitanischen Hotels und werden alsbald von einem Krankenwagen abtransportiert, da sie sich an einer Austernsuppe vergiftet haben. Nena Daconte und ihr Verlobter Billy Sánchez, zwei Sprösslinge der kolumbianischen Oligarchie auf Hochzeitsreise in Frankreich, werden dagegen jäh aus ihrem Eheglück gerissen: Nena sticht sich am Dorn einer Rose und verblutet an dieser harmlosen Wunde.
Äußerst humorvoll schildert García Márquez die fantastischen Abenteuer seiner Protagonisten, so als handele es sich um Belanglosigkeiten und Lappalien, die man ganz selbstverständlich hinnimmt. Denn in Kolumbien gehören solche kleinen und größeren Katastrophen zum Alltag; man nimmt sie einfach wahr oder kommentiert und bespricht sie wie Anekdoten und Zeitungsmeldungen. Diese humorvolle, etwas elegische Gelassenheit, die man beinahe als Nationalcharakter bezeichnen könnte, kennzeichnet auch die Lebenseinstellung und das Gesamtwerk von Gabriel García Márquez, von dem drei Romane es zu Weltruhm gebracht haben.
Mit Hundert Jahre Einsamkeit (1970) läutete er nicht nur den Boom der lateinamerikanischen Literatur in Europa ein, sondern schuf ein Werk, das bis heute zum Kanon der sogenannten Weltliteratur zählt. In diesem Epos beschreibt er auf fantasievolle, heitere Art und Weise den Aufstieg und Niedergang des fiktiven Dorfes Macondo und die sechs Generationen währenden Lebenswege der Familie Buendía.
Chronik eines angekündigten Todes (1981) beruht wiederum auf einer wahren Begebenheit und greift einen anachronistischen Ehrenkodex auf, der zum Tod des Protagonisten Santiago Nasar führt. Ähnlich wie in seinen anderen Werken spielt der Begriff der Zeit und deren Stillstand hier eine wichtige Rolle. Angela Vicario, die Braut des wohlhabenden Ingenieurs Bayardo San Román, muss ihr Dorf verlassen, da sie vor ihrer Hochzeit von Santiago »entehrt« wurde. Sie schreibt ihrem ehemaligen Verlobten daraufhin nun ihr halbes Leben lang Briefe, bis sie dreiundzwanzig Jahre später, zurück in ihrem Dorf, wieder auf ihn trifft. Nach einigem Zögern entschließt er sich, erneut um ihre Hand anzuhalten. Doch diese Schlußepisode ist, so rührend sie auch wirken mag, eher als eine scherzhafte Metapher aufzufassen, die auf den humoristischen Charakter der Handlung verweist.
Das Motiv der stillstehenden Zeit oder Zeitlosigkeit ist ebenfalls in Liebe in den Zeiten der Cholera (1987) anzutreffen. García Márquez schildert in diesem allseits beliebten Roman, der 2007 verfilmt wurde, die Liebe zwischen seinen beiden Protagonisten Fermina Daza und Florentino Ariza. Sie überdauert viele Hindernisse und Jahrzehnte und wird von ihm als authentisch und glücklich dargestellt. Fast könnte man meinen, dass er hiermit seiner Ehefrau Mercedes, mit der er ein Leben lang verheiratet war, ein kleines literarisches Denkmal setzen wollte.
Obwohl sich Gabriel García Márquez in seinen literarischen und journalistischen Schriften auch mit Politik befasst hat, sich in ›Die Abenteuer des Miguel Littín‹ (1986) mit der chilenischen Diktatur unter Augusto Pinochet auseinandersetzt und ein bekennender Sozialist und Freund Fidel Castros war, sind es die allgemein menschlichen Themen, die seine Bücher dominieren und dem Leser in Erinnerung bleiben. Fröhlich, warm, den Menschen freundlich zugewandt, bar jeglicher Ironie wirken seine Erzählungen und Romane, in denen es kaum richtige Bösewichte gibt und die meist gut enden.
Auch im wahren Leben handelte er nach dieser Maxime. So etwa, als er 1985 in Kuba die renommierte Internationale Hochschule für Film und Fernsehen gründete und somit der kubanischen Jugend den Anschluss an den Rest der Welt ermöglichte. Oder als er sich, jegliche finanziellen Eigeninteressen außer Acht lassend, vor einigen Jahren für einen erkrankten Landsmann und bekannten Schriftstellerkollegen einsetzte. In diesem Jahr wäre Gabriel García Márquez 90 Jahre alt geworden; kürzlich ist, fünfzig Jahre nach dem Erscheinen der Originalausgabe, eine deutsche Neuübersetzung von Hundert Jahre Einsamkeit erschienen. Sie ist nach wie vor noch eine lohnende Lektüre.
Titelangaben
Gabriel Garcia Márquez: Hundert Jahre Einsamkeit
Aus dem Spanischen von Dagmar Ploetz
Köln: Kiepenheuer & Witsch 2017
528 Seiten, 25.- Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
reinschauen
| Leseprobe