Kunst | Kunst sammeln mit wenig Geld Nr. 1 – Wie man Kunstsammler werden kann
Die enormen Millionenbeträge, die in jüngerer Zeit bei den Versteigerungen der großen Auktionshäuser in New York und London für herausragende Bilder und Skulpturen erzielt worden sind, unterstützen die gängige Vorstellung, dass Kunst nur etwas für äußerst Wohlhabende ist. Von PETER ENGEL
Für ein bestimmtes Segment des Kunstmarktes trifft das auch zu, da jagen sich Superreiche gegenseitig die letzten verfügbaren Picassos und van Goghs ab, oder was gerade obenan in der Hitliste steht, und die dabei gezahlten Unsummen haben nicht selten mehr mit dem Prestigedenken der Beteiligten und mit kalkulierter Geldanlage als mit Kunstliebe oder gar mit Sachverstand zu tun.
Aber es geht auch ganz anders, und ein nicht geringer Teil der heutigen Kunstsammler ist nicht mit übermäßigen Finanzmitteln gesegnet. Selbst mit vergleichsweise wenig Geld lässt sich aber eine niveauvolle Kollektion durchaus aufbauen, insbesondere dann, wenn man die Tugend der Geduld übt, sie dazu mit Findigkeit und Geschmack paart. Ein Kunstsammler dieser Kategorie wird zwar Versteigerungen wichtiger Auktionshäuser gern besuchen und sich dort von der prickelnden Atmosphäre anstecken lassen, aber in die mitunter hektischen Bietergefechte dürfte er nur in sehr raren Ausnahmefällen eingreifen – und im Hochpreisbereich eben gar nicht.
Ein Sammler mit beschränkten Mitteln setzt eher auf die kleinen Versteigerungsfirmen, die in Deutschland über alle Regionen hin weit gestreut sind. Dort, in der häufig gar nicht so provinziellen Provinz, kann er am ehesten auf ein »Schnäppchen« hoffen, ein in seinem tatsächlichen Wert nicht ganz richtig erkanntes Kunstwerk. Die Stunde des kenntnisreichen Sammlers schlägt dann, wenn er ein für wenig Geld angebotenes gutes oder gar meisterliches Bild unter viel Mittelmaß und noch mehr Schlechtem herausfindet und es günstig erwirbt. So etwas geschieht immer einmal wieder, und wohl jeder engagierte Sammler weiß von einem derartigen Glücksfall zu berichten.
Für einen wenig Betuchten wäre es etwa auch ratsam, sich ein Sammelgebiet zu erschließen, das bis dahin vernachlässigt wurde und das gewöhnlich mit mäßigen Preisen einhergeht. Ein Beispiel wären Ausstellungsplakate, die zwar von bestimmten Museen sogar systematisch zusammengetragen werden, sich aber bei Privatsammlern noch keiner großen Gunst erfreuen.
Wenn man dazu noch weiß, dass etwa zu DDR-Zeiten viele Plakate der Galerien von den besten Künstlern gestaltet, dazu meist in kleinen Auflagen gedruckt und häufig von den Malern sogar signiert wurden, dann hätte man schon ein sehr lohnendes Sammelgebiet, zumal die Preise für solche Originalgraphiken derzeit eher gering sind.
Wer sich in das Gebiet der vervielfältigten Kunst, also der Radierungen, Lithographien, Holzschnitte oder Siebdrucke, stürzen will, hat ein schier uferloses Reservoir vor sich. Die Ausmaße zeigen sich heute am ehesten im Internet, denn die Galerien haben sich nach dem dramatischen Preisverfall seit den 70er Jahren aus dem Handel mit solchen Werken weitgehend zurückgezogen, von Ausnahmen im hochpreisigen Segment abgesehen.
Die meisten Geschäfte mit Graphik dürften im Internet über ebay abgewickelt werden, aber auch speziell auf bildende Kunst ausgerichtete andere Portale mischen kräftig mit. Dort gibt es für ernsthafte Sammler viele Chancen, aber es lauern auch nicht unbeträchtliche Gefahren.
Die unterschiedlichen Typen von Kunstsammlern
Über Sammler von Kunstwerken ist schon viel geschrieben und nachgedacht worden, gewöhnlich gelten sie als glückliche Menschen mit ausgeprägtem Geschmack und soliden Kenntnissen auf ihrem Spezialgebiet. Dieser Typus des »reinen« Sammlers, der in erster Linie Freude an seinen erworbenen Schätzen hat und sie anderen auch gern zeigt, ohne damit allerdings protzen zu wollen, leistet zudem durch seine Tätigkeit viel für den Erhalt des kulturellen Erbes. Diesem Ideal steht der »Ansammler« gegenüber, der mehr auf die Quantität seiner Stücke setzt als auf deren Qualität, der wahllos anhäuft und auf Besitz aus ist. Noch unerfreulichere Kunstsammler sind jene Spekulanten, denen es in erster Linie um lukrative Geldanlagen und jederzeitige Gewinnmitnahme geht, wenn ihr Investment erfolgreich war.
»Die eine Hälfte des Kunstwerks macht der Künstler. die andere vollendet der Sammler«, soll Marcel Duchamp einmal gesagt haben, der Erfinder des Readymade und folgenreiche Umwerter in der Moderne. An dem bewusst paradoxen Wort ist immerhin richtig, dass Sammler von Kunstwerken in gewisser Weise auch Gestalter sein können, etwa wenn sie ihre Schätze später einmal gezielt einem Museum zukommen lassen.

Untersucht man die Motive von Kunstsammlern, so stößt man neben der puren Augenlust und anderen ästhetischen Verkleidungen ihrer Leidenschaft, die im Einzelfall durchaus zu einer Art Besessenheit führen kann, auch auf Beweggründe wie Neugier auf Neues, Interesse am Aufspüren des Besonderen und Seltenen, schließlich auch auf die reine Wissbegierde, einen ganzen Bereich der bildenden Kunst bis in die letzten Verästelungen hinein zu kennen und zu erforschen.
Zu den hervorstechenden Eigenschaften eines »richtigen« Sammlers gehört in jedem Falle ein besonderer Spürsinn dafür, was ein Kunstwerk zu einem Objekt des Begehrens macht, ihn zeichnet eine immer wache Bereitschaft aus, auf neue Entwicklungen einzugehen, dazu ein umfassendes Bemühen um Informiertheit und eine stark entwickelte Beharrlichkeit im Verfolgen von Zielen. Auch die Fähigkeit zur Kommunikation, zum Austausch von Meinungen mit anderen und notfalls zur Korrektur irriger Annahmen sollte ein Kunstsammler aufbringen, der lebenslang ein Lernender bleiben sollte, um wirkliche Kennerschaft zu erlangen.
Alle Titel dieser Reihe
| Teil 1: Wie man Kunstsammler werden kann
| Teil 2: Sammeln mit Hilfe des Internets
| Teil 3: Chancen bei den kleinen Auktionshäusern
| Teil 4: Kunsterwerb beim Atelierbesuch
| Teil 5: Echtes und Falsches in der Kunst



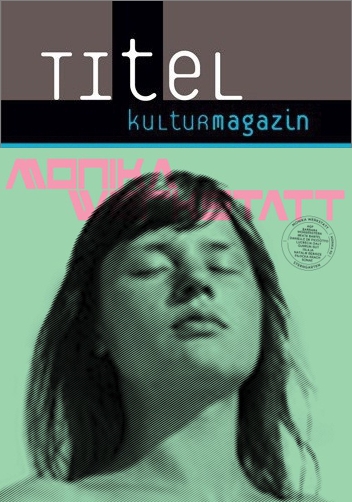



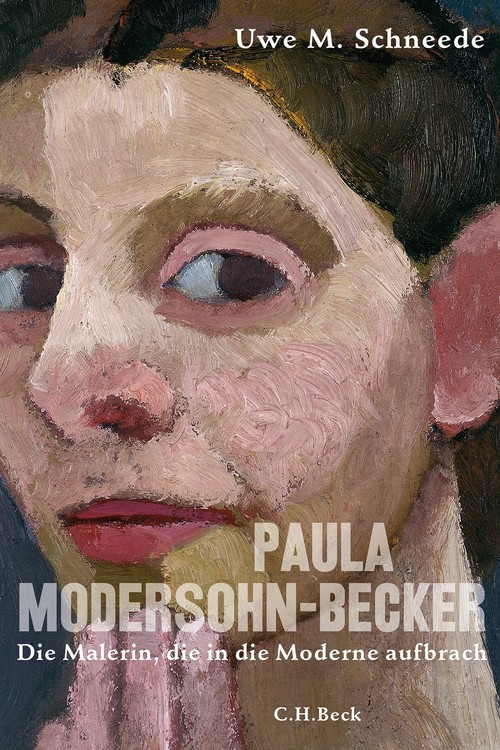

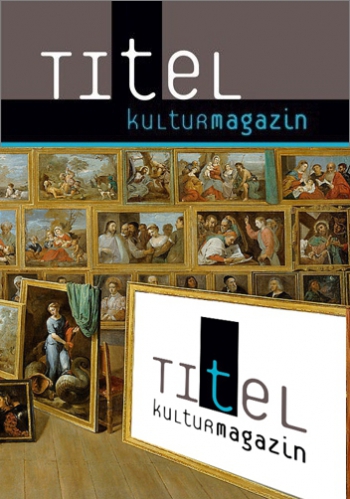

[…] erschienen | Wie man Kunstsammler werden kann – in TITEL kulturmagazin | Sammeln mit Hilfe des Internets in TITEL […]
[…] erschienen | Wie man Kunstsammler werden kann – in TITEL kulturmagazin Nächste Folge | Chancen bei den kleinen […]