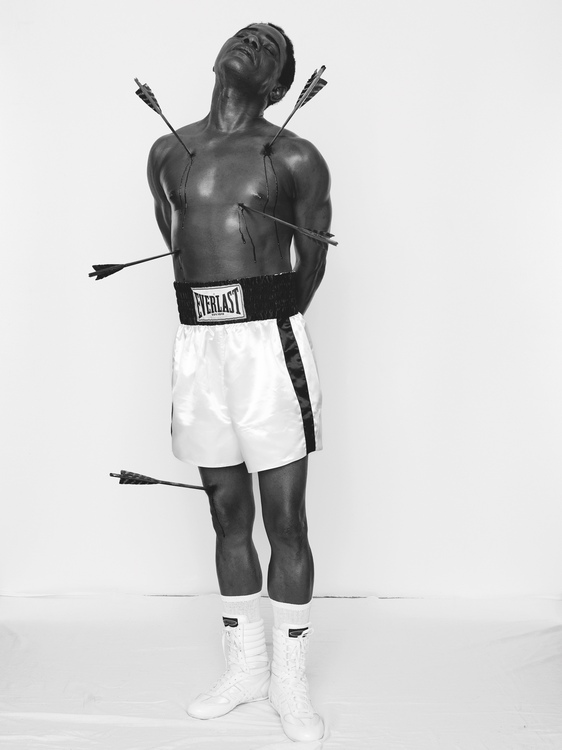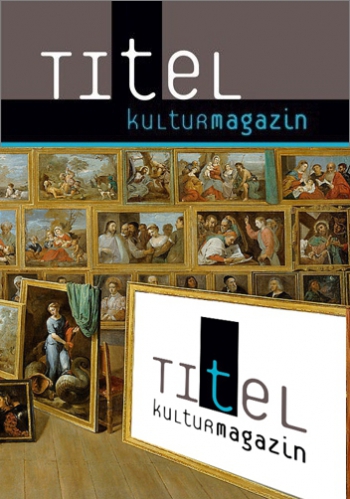Kunst | Kunst sammeln mit wenig Geld, Nr. 4 – Kunsterwerb beim Atelierbesuch
Es soll tatsächlich Sammler zeitgenössischer Kunst geben, die ihre bevorzugten Maler oder Bildhauer gar nicht selbst kennenlernen wollen. Von PETER ENGEL
Sie seien ausschließlich am Werk der von ihnen gesammelten Künstler interessiert, erklären sie ihre Einstellung, nicht an der Person des jeweiligen Schöpfers, der womöglich unsympathisch sei und so das eigene Schaffen relativiere. So eine Position ist aber denkbar selten, denn in aller Regel sind Atelierbesuche für Kunstsammler äußerst erstrebenswert.
Mehrere Motive kommen dabei zusammen, und eine mögliche Neuerwerbung steht nicht immer im Vordergrund. Es kann in jedem Fall höchst aufschlussreich sein, den Künstler in seiner eigenen Welt zu erleben, ihm sogar – wenn man Glück hat – beim Mal-Akt zuzuschauen, oder bei der sonstigen Realisation eines Werkes. Man wird im Atelier häufig ältere Arbeiten eines Künstlers vorfinden, die im Handel womöglich gar nicht präsent sind, erfährt auf diese Weise auch etwas über seinen Werdegang.
Zwar sind manche Maler und Bildhauer vertraglich an eine Galerie gebunden und dürfen demnach privat nicht günstiger eigene Werke verkaufen als ihr Galerist; das gilt allerdings nur für eine vergleichsweise kleine Gruppe von »Stars«, und auch da soll es mitunter »Regelverstöße« geben. Ein nicht ganz so gefragter Künstler wird gewöhnlich einem engagierten Sammler, der vielleicht schon Werke von ihm besitzt, preislich durchaus entgegenkommen, wenn er eine bestimmte Arbeit direkt aus dem Atelier erwerben möchte. Diesen Handel kann der Künstler umso leichter eingehen, weil er ja den Teilbetrag des Verkaufspreises, den ansonsten seine Galerie einstreicht, bei einem Privatverkauf selbst erhält. Wenn er unter dem üblichen Galeriepreis bleibt, aber über seinem gewöhnlichen Fixum, ist so ein privates Arrangement für ihn sogar lukrativ – und für den Interessenten selbstverständlich ebenfalls.
Für einen Sammler kann ein Atelierbesuch auch deshalb wünschbar sein, weil er in der Werkstatt des Künstlers nicht selten auf eine größere Auswahl von Arbeiten trifft, wie er sie in einer Galerie gar nicht zu sehen bekäme. Vielleicht auch im Hinblick auf Werke, die der Künstler aus bestimmten Gründen zurückgehalten hat, einem besonders interessierten Besucher aber zu zeigen – und zu verkaufen – bereit ist.
Tatsächlich können Ateliers äußerst unterschiedlich sein, wie eben die Künstler auch, die diese Arbeitsräume nutzen. In nicht wenigen Fällen befinden sie sich in der eigenen Wohnung, denn spezielle Werkstätten – am besten mit Oberlicht – für bildende Künstler sind eher rar und dazu teuer. Die Bandbreite von Ateliers reicht von der aufgeräumten nüchternen Werkstatt bis zu vollgestopften Rumpelkammern, in denen sich der Künstler kaum selbst auskennt. Was man aber wohl immer finden dürfte, ist eine bestimmte Stelle im Atelier, wo Kataloge oder anderes Bildmaterial aufbewahrt werden. Dafür wird sich ein engagierter Sammler, der möglichst viel über einen von ihm bevorzugten Künstler erfahren möchte, immer interessieren, und wenn er das Atelier auch nicht mit einer Neuerwerbung verlässt, dann vielleicht mit einem kleinen Bändchen, das ihm auf seine Bitte hin sicher signiert und – wenn er einen besonders glücklichen Moment erwischt – möglicherweise sogar mit einer kleinen Zeichnung »getrüffelt« wird, wie es im Fachjargon heißt.

Man darf sich Atelierbesuche übrigens nicht so einseitig vorstellen, dass nur die Besucher als die Nehmenden erscheinen. Während es für manche Künstler lästige Pflichtaufgaben sind, wenn sie interessierten Besuchern ihr Arbeitsfeld zeigen, haben andere selbst Vergnügen an solchen Präsentationen. Besonders dann natürlich, wenn sie auf kundige Sammler treffen, die ihnen über ihre Werke nicht nur Schmeichelhaftes, sondern Sachverständiges sagen, mit denen sie also in einen Dialog eintreten können, bei dem mitunter auch kritische Akzente gesetzt werden können. Das ist manchen Künstlern durchaus willkommen, schärft vielleicht sogar die Sicht auf ihr eigenes Werk und kann so ein Gewinn sein, der nicht in Geldscheinen aufzuwiegen ist.
Alle Titel dieser Reihe
| Teil 1: Wie man Kunstsammler werden kann
| Teil 2: Sammeln mit Hilfe des Internets
| Teil 3: Chancen bei den kleinen Auktionshäusern
| Teil 4: Kunsterwerb beim Atelierbesuch
| Teil 5: Echtes und Falsches in der Kunst