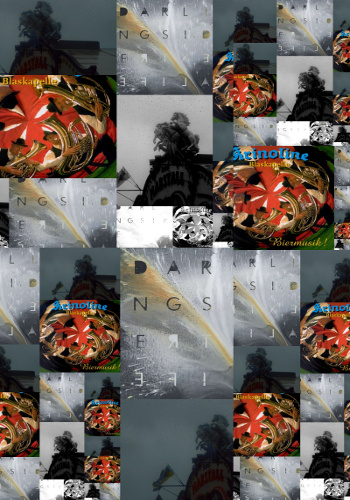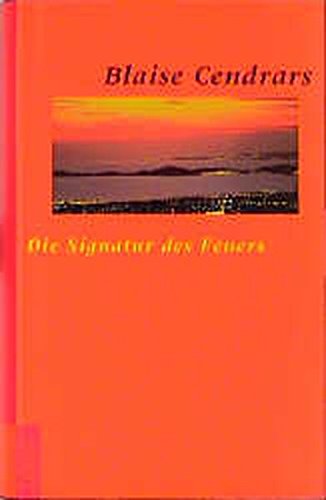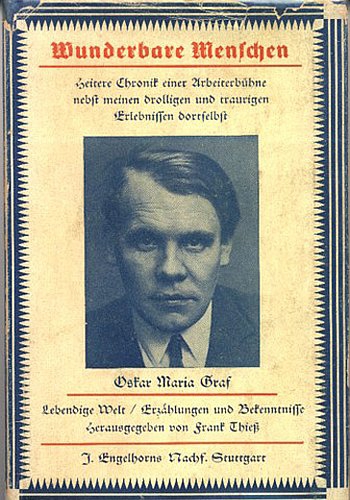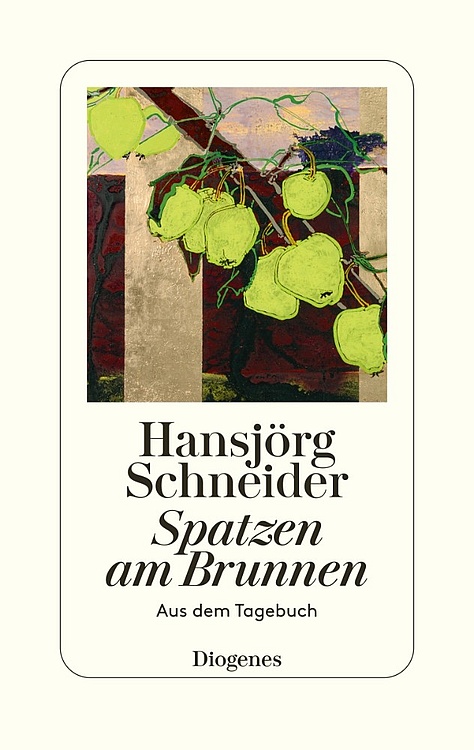Menschen | Olga Tokarczuk und Peter Handke
Die Literatur-Nobelpreisträger für die Jahre 2018 und 2019 wurden gestern von der Stockholmer Akademie bekannt gegeben. Die mit jeweils rund 830.000 Euro dotierten Auszeichnungen gehen an Olga Tokarczuk und Peter Handke. Die Doppel-Vergabe war wegen eines Skandals (verbunden mit mehreren Rücktritten) im Nobelpreiskomitee nötig geworden. Von PETER MOHR
In der Jurybegründung für Olga Tokarczuk wurde ihre „erzählerische Vorstellungskraft, die mit enzyklopädischer Leidenschaft das Überschreiten von Grenzen als Lebensform darstelle“ gerühmt.
Tokarczuk, die am 29. Januar 1962 in Sulechów geboren wurde, studierte Psychologie in Warschau, arbeitete mit verhaltensaufälligen Jugendlichen und arbeitete einige Jahre als Therapeutin in Breslau (Wroclaw). In einem Interview mit dem Deutschlandfunk hatte die Autorin vor drei Jahren erklärt: „Die Geschichte Wroclaws ist faszinierend, sie ist noch nicht bis zu Ende erzählt. Wir schenken der deutschen Vergangenheit der Stadt zu wenig Aufmerksamkeit.“ Ihr damals geäußerter Wunsch klingt heute beinahe absurd: „Ich würde es begrüßen, wenn zum Beispiel die Straßen nach deutschen Berühmtheiten, wie deutschen Nobelpreisträgern, benannt werden würden.“
23 Jahre nach der Lyrikerin Wislawa Szymborska geht der Nobelpreis wieder an eine polnische Schriftstellerin. Allerdings an eine, die in ihrer Heimat wegen ihrer öffentlichen Kritik an der polnischen Verweigerung zur Flüchtlingsaufnahme heftig angefeindet wurde.
1989 hatte Tokarczu mit „Städte in Spielen“ ihr Debüt gefeiert, ihr großer Durchbruch gelang ihr sieben Jahre später mit „Ur und andere Zeiten“. Die literarische Psychologin, deren Werke in 28 Sprachen übersetzt wurden, sieht sich selbst in der geistigen Tradition CG Jungs. Im letzten Jahr war Tokarczuk für ihren Roman „Unrast“ mit dem Booker-Preis ausgezeichnet worden. Der Roman war 2009 in deutscher Übersetzung bei Schöffling erschienen, war aber zuletzt nicht mehr lieferbar.
Die Kritikerin Marta Kijowska hatte Tokarczuks Werk in der „Süddeutschen Zeitung“ vor einigen Jahren völlig zutreffend „eine unnachahmliche, zwischen Magie und Realität oszillierende Aura“ attestiert.
Während die Preisvergabe an Tokarczuk durchaus überraschend kam, wurde mit dem Österreicher Peter Handke für das Jahr 2019 ein Schriftsteller geehrt, der seit vielen Jahren immer wieder als „heißer Kandidat“ gehandelt worden war. Die Jury lobte Handke „für ein einflussreiches Werk, das mit linguistischem Einfallsreichtum die Randbereiche und die Besonderheit der menschlichen Erfahrung erforscht“ habe.
Peter Handke liebt das Extreme. Mit seinem umfangreichen literarischen Werk und seinen spektakulären öffentlichen Auftritten hat er stets – und dies bewusst – polarisiert. Reichlich Aufsehen erregte er auch durch seine (kaum nachvollziehbare) Nähe zum serbischen Diktator Slobodan Milosevic.
Auch an seinem „letzten Epos“ (Die Obstdiebin oder Einfache Fahrt ins Landesinnere“, 2017, Suhrkamp), wie Handke sein jüngstes Werk selbst bezeichnete, haben sich die Geister geschieden. Es ist ein Buch über alles und nichts, das mit diversen Querverweisen auf frühere Werke (u.a. „Versuch über die Jukebox“, 1990 und „Bildverlust“, 2002) ausstaffiert ist. In einer Mischung aus Gesang, Meditation und Prosagebet lässt Handke einen namenlosern Ich-Erzähler als Flaneur durch die Straßen von Paris streifen, durch seine vielbeschworene „Niemandsbucht“.
Später taucht die Obstdiebin Alexia auf, eine seltsame Mischung aus Heilige und Sünderin. Sie stammt aus der unendlichen Ferne des realen Sibiriens und mutet doch wie ein paradiesisches Wesen an, eine moderne „Seherin“, der ein digitales Textband in einer Art Dauerschleife vor den Augen erscheint. Sie reist von Paris aus in die Abgeschiedenheit der Picardie, wo Handke seit einigen Jahren einen Zweitwohnsitz als eine Art Rückzugsort hat – getrieben von einer mysteriösen Sehnsucht nach „Stillezufuhr.“ Hin und wieder gibt sich sogar der ewig zornige, gealterte Rebell in der „Obstdiebin“ zu erkennen, etwa wenn er über die Journalisten verbal herfällt: „Geheimbündler und Verschwörer einer Elite, die niemand braucht, und eine Macht, die es längst nicht mehr gibt. Verschont uns wenigstens hier, in der Wirklichkeit.“
Das erinnert tatsächlich ein wenig an den rebellischen Gestus aus Handkes literarischer Anfangszeit. Als junger Mann brüskierte er 1966 die arrivierte deutschsprachige Literatengilde der Gruppe 47 auf ihrer Jahrestagung in Princeton und attestierte der Nachkriegsliteratur eine „Beschreibungsimpotenz“. Ein Mann von 23 Jahren, der gerade seinen ersten Roman „Die Hornissen“ durch Alfred Kolleritschs Fürsprache beim Suhrkamp Verlag veröffentlicht hatte, zog Heinrich Bölll, Günter Grass, Alfred Andersch, Peter Weiss und all die anderen renommierten Autoren durch den Orkus. „Die Sprache bleibt tot, ohne Bewegung, dient nur als Namensschild für die Dinge“, lautete sein Vorwurf.
Peter Handke, der am 6. Dezember 1942 in Griffen (40 km östlich von Klagenfurt) als uneheliches Kind in kleinbürgerlichen Verhältnissen (er selbst bezeichnete sich als „Kleinhäuslersohn“) geboren wurde, besuchte zunächst das katholische Internat in Tanzenberg, dann ein Gymnasium in Klagenfurt. Erst kurz vor Beginn seines Jurastudiums in Graz, das er 1966 nach seinen ersten literarischen Erfolgen abbrach, erfuhr Handke, dass der Ehemann seiner Mutter nicht sein leiblicher Vater ist.
Eine ganze Generation Gymnasiasten und Studenten wurde mit den Handke-Büchern „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ (1970/später verfilmt von Wim Wenders), „Wunschloses Unglück“ (1972), „Der kurze Brief zum langen Anschied“ (1972) und „Die linkshändige Frau“ (1976/Handke schrieb später auch das Drehbuch zur Verfilmung) literarisch sozialisiert. In den 70er Jahren war aus dem „enfant terrible“ eine Art Pop-Star der Literaturszene geworden, der stets prominente Frauen an seiner Seite hatte: die Schauspielerinnen Libgart Schwarz und Sophie Semin (mit denen er jeweils eine Tochter hat), Jeanne Moreau und Katja Flint.
„Der größte Erfolg war ganz einfach der, dass ich schreiben konnte und publiziert wurde. Sich die Zeit zu nehmen, sie fruchten zu lassen, das ist schon ein Erfolg“, erklärte Handke in einem Interview rückblickend auf seine Anfangsjahre. Und heute dürfen wir fast) sicher sein, dass die „Obstdiebin“ nicht das „letzte Epos“ des großen, leicht kauzigen Individualisten Peter Handke war.
Was beide Preisträger verbindet: Sowohl Olga Tokarczuk als auch Peter Handke sind keine Mainstream-Autoren, sie schwimmen beide gern und leidenschaftlich gegen den Strom des Zeitgeistes.
Bei Schöffling & Co. ist »Der Gesang der Fledermäuse« lieferbar bzw. befindet sich im Nachdruck