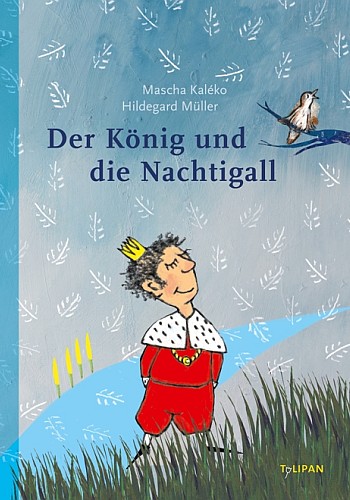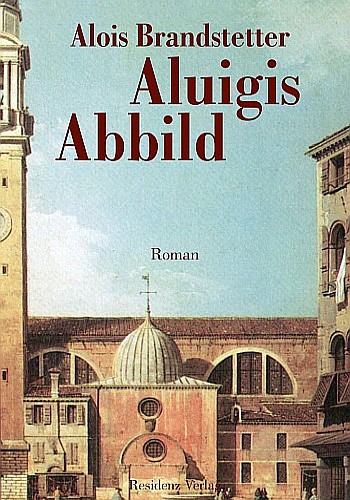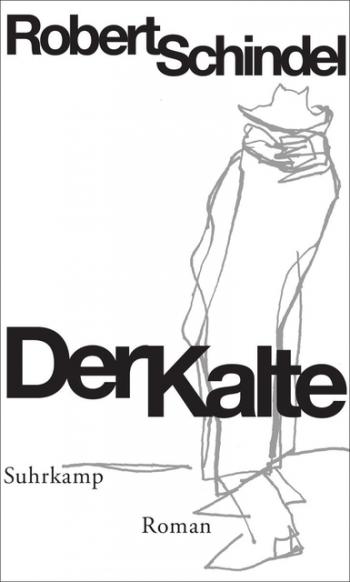Roman | Sibylle Lewitscharoff: Von oben
Die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff, die im Frühjahr ihren 65. Geburtstag gefeiert hat, ist in den letzten Jahren nicht aus den Schlagzeilen heraus gekommen. Ihr wurden für ihre stets sehr kopflastigen Erzählwerke fast alle wichtigen Literaturpreise im deutschsprachigen Raum verliehen (u.a. 2013 der Georg-Büchner-Preis), und im März 2014 wurde sie nach ihrer mehr als umstrittenen Dresdner Rede im Staatsschauspiel zur Zielscheibe der Kritik. Von PETER MOHR
Pornographie, künstliche Befruchtung, Leihmutterschaft und Abtreibung hatte sie in ihrem Redebeitrag derart unglücklich miteinander vermengt, dass der Berliner Journalist Dirk Knipphals damals (völlig zutreffend) von »einer schrecklichen, menschenverachtenden Tirade« sprach. Die öffentliche Entrüstung war vor fünf Jahren riesengroß, wenn gleich es auch Beifall aus dem national-konservativen Lager gab.
 »Das eigene Leben ist das Fleisch in der Suppe. Daran führt kein Weg vorbei, bei jedem Schriftsteller, wobei vollkommen wurscht ist, was er schreibt«, hatte Lewitscharoff einmal ihr eigenes dichterisches Credo beschrieben. In ihrem neuen Roman entführt sie die Leser in eine Art Zwischenreich, eine kühn konstruierte Ebene zwischen dem Berliner Alltag und dem Totenreich. Das eigene Leben als Fleisch in der Suppe lässt sich so allerdings nur als Geschmacksverstärkerkonzentrat erahnen.
»Das eigene Leben ist das Fleisch in der Suppe. Daran führt kein Weg vorbei, bei jedem Schriftsteller, wobei vollkommen wurscht ist, was er schreibt«, hatte Lewitscharoff einmal ihr eigenes dichterisches Credo beschrieben. In ihrem neuen Roman entführt sie die Leser in eine Art Zwischenreich, eine kühn konstruierte Ebene zwischen dem Berliner Alltag und dem Totenreich. Das eigene Leben als Fleisch in der Suppe lässt sich so allerdings nur als Geschmacksverstärkerkonzentrat erahnen.
Auf genau diesem Territorium bewegt sich die als »Seelenmotte« bezeichnete, bereits verstorbene Hauptfigur. Er schwebt wie ein metaphysischer Beobachter über der Großstadt. Ein Mann, der zu Lebzeiten Philosophieprofessor war und dessen Erinnerungen sich hinter einem Nebelschleier bewegen. Jede Menge Heidegger »geistert« dem Beobachter »von oben« durch den Kopf. Bei dieser erzählerischen Geisterstunde fühlt man sich sogleich an Lewitscharoffs Vorgängerroman Killmousky (2014) erinnert, in dem bekanntlich eine Katze die Hauptfigur war.
Der Protagonist bewegt sich schlafwandlerisch durch den »Berliner Stadtfladen«, begibt sich durch offene Balkontüren in Wohnungen, beobachtet die Menschen, Fremde wie einstige Freunde. Die so gewonnenen Einblicke in die Welt der Lebenden sind alles andere als friedvoll. Ein junger Mann wird zu Tode geprügelt, eine Frau sucht den Freitod und springt vom Dach eines Hauses. Abgründe tun sich allenthalben auf, er erblickt die kleinen Katastrophen in den Wohnzimmern der ganz »normalen« Mitbürger.
Aber Lewitscharoff geht es um mehr, sie greift wieder zum verbalen Brecheisen, lässt den Geist voller Häme über die Berliner Intellektuellenszene der letzten Jahrzehnte polemisieren. Alle bekommen ihr Fett ab, die Marxisten, die Poststrukturalisten um Derrida und die Gegenwartslyriker (mit Ausnahme von Durs Grünbein).
Das wirkt alles arg konstruiert, gerade so, als habe Lewitscharoff inzwischen großen Spaß an der Polemik, an provozierenden Simplifizierungen im Boulevardstil gefunden. Da ist die Rede von einem »pseudointellektuellen Dummkopf« und »misogynen Trophäensammler«; die eingestreuten Kafka-Befunde des Erzähl-Ichs wirken ebenso flach und wenig substanziell wie der Besuch am Küchentisch der in einem graukarierten Bademantel gekleideten Angela Merkel.
Der Blick »von oben« soll eine theologisch-philosophische Perspektive eröffnen und zu einem intellektuellen Denkspiel im Konjunktiv animieren. Der Flapsigkeit des Jargons ist es allerdings geschuldet, dass all diese Spitzen und Seitenhiebe, die kleinen und großen Sticheleien, die eher an scharfzüngige Glossen denn an Literatur erinnern, ohne nachhaltige Wirkung am Leser vorbeirauschen.
»Will man sich nicht der komplexen Sinnlosigkeit der Existenz ausliefern, muß es eine Instanz geben, die urteilt und dabei über einen schärferen Blick verfügt, als er uns gegeben ist«, heißt es im Roman. Eine ordnende künstlerische Instanz mit einem weniger verschwommenen Blick und einem weniger radikalen Tonfall hätte diesem Roman fraglos auch gut getan.
Man kann sich des Gefühls nicht erwehren, dass Sibylle Lewitscharoff in den letzten Jahren künstlerisch ein wenig auf der Stelle tritt. »Nicht die Liebe vermag die Toten in Schach zu halten, denke ich, nur ein gutmütig gepflegter Haß«, lautete schon der Schlusssatz ihres 2007 erschienenen Romans Apostoloff.
Titelangaben
Sibylle Lewitscharoff: Von oben
Berlin: Suhrkamp Verlag 2019
240 Seiten, 24.- Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe
| Lesen Sie mehr über Sibylle Lewitscharoff in TITEL kulturmagazin