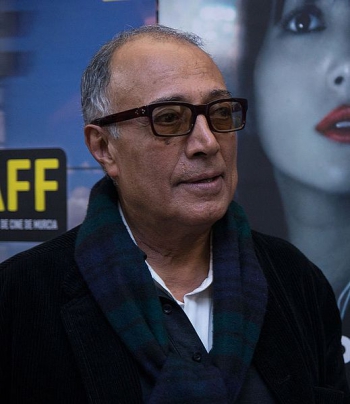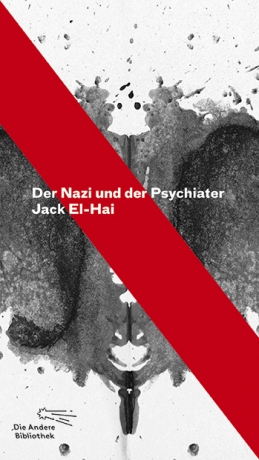»Immer wieder geschieht es mir, dass ich, wenn ich Jahnn lange nicht gelesen habe, bei erneuter Lektüre stutze und verharre wie ein Pferd, das sich seines Reiters erst entsinnen muss«, schrieb vor knapp fünf Jahren der langjährige Zeit-Feuilletonchef Ulrich Greiner über sein ambivalentes Verhältnis zu Hans Henny Jahnn. Von PETER MOHR
 Hans Henny Jahnn war zeitlebens eine äußerst vielseitige und umstrittene Figur: Romancier, Dramatiker, Orgelbauer, Komponist, Missionar, Hobby-Architekt, Hormonforscher und Pferdezüchter in einer Person. Doch über all dem thronte eine verbindende Lebensmaxime, die er im Februar 1935 auf einem Vortrag im norwegischen Bergen zum Ausdruck brachte: »Auf allen Wegen und Abwegen ist der Dichter Schrittmacher des Humanismus, des Erbarmens. Er fordert Gnade für Mensch, Tier, Baum und Stein.«
Hans Henny Jahnn war zeitlebens eine äußerst vielseitige und umstrittene Figur: Romancier, Dramatiker, Orgelbauer, Komponist, Missionar, Hobby-Architekt, Hormonforscher und Pferdezüchter in einer Person. Doch über all dem thronte eine verbindende Lebensmaxime, die er im Februar 1935 auf einem Vortrag im norwegischen Bergen zum Ausdruck brachte: »Auf allen Wegen und Abwegen ist der Dichter Schrittmacher des Humanismus, des Erbarmens. Er fordert Gnade für Mensch, Tier, Baum und Stein.«
Vor 125 Jahren wurde das Multitalent als Sohn eines Schiffszimmermannes im Hamburger Stadtteil Stellingen unter dem Namen Hans Henry August Jahn geboren. Den später in die Literaturgeschichte eingegangenen Namen gab sich der Dichter im Jahre 1913 nach Abschluss der Oberrealschule, als er bereits erste literarische Versuche hinter sich hatte.
Einer größeren künstlerischen Öffentlichkeit wurde Jahnn 1920 bekannt, als er von Oskar Loerke für den ›Pastor Ephraim Magnus‹ den Kleist-Preis zugesprochen bekam. Eine ganz wichtige Lebensetappe – des ewig Heimatlosen – war bereits beendet: Das erste Exil, das den radikalen Pazifisten während des Ersten Weltkrieges nach Norwegen führte.
1923 wurde nicht nur der ›Pastor Ephraim Magnus‹ in Berlin uraufgeführt – ein durch und durch expressionistisches Stück mit heftigen Attacken gegen Staat, Kirche und Gesellschaft -, sondern Jahnn begann fast zur gleichen Zeit mit der Restaurierung der Arp-Schnitger-Orgel in der Hamburger Jacobikirche.
Mithilfe der Dichtkunst, der Musik (es sind Eigenkompositionen aus dem Jahr 1915 erhalten) und der von ihm 1920 ins Leben gerufenen Glaubensgemeinschaft ›Ugrino‹ entwickelte sich Jahnn immer stärker zum Visionär, der einen kollektiven Untergang vor Augen hatte.
Nach seiner an die griechische Antike angelehnten Tragödie ›Medea‹ (1926) erschien drei Jahre später der erste monumentale Prosa-Entwurf mit dem Titel ›Perrudja‹. Dieses fragmentarische Epos, das gleichermaßen Züge von Kafka und Musil erkennen lässt, thematisiert das breite Spektrum der libidinösen Irrungen und Wirrungen. Jahnn reduziert das Denken und Handeln seines Anti-Helden ›Perrudja‹ auf beinahe archaische Triebe.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten musste Hans Henny Jahnn ein zweites Mal Deutschland verlassen. Über die Schweiz gelangte er nach Bornholm, wo er sich für über fünfzehn Jahre lang auf einem Bauernhof niederließ und sich neben seinen schriftstellerischen Arbeiten der Hormonforschung und Pferdezucht widmete.
Nach Kriegsende, noch ehe das von den Nationalsozialisten verbotene Drama ›Armut, Reichtum, Mensch und Tier‹ 1948 in Hamburg fünfzehn Jahre nach Fertigstellung zur Uraufführung kam, wurde von den dänischen Behörden Jahnns Vermögen konfisziert. Der Lebensgrundlage beraubt, kehrte er widerwillig 1950 nach Hamburg zurück, wo zur gleichen Zeit die unvollendet gebliebene Roman-Trilogie ›Fluß ohne Ufer‹ erschien.
»Ich entsinne mich, ich lag wachend, mit weit geöffneten Augen schaute ich das Dunkle an. Eine Welt, die durch keinen Gedanken und keine Assoziation zusammengehalten wird. Nur Bilder«, notierte Jahnn über das Entstehen dieses Werkes. Zwar schrieb der Autor ungebrochen weiter, doch seine Stücke wurden immer düsterer; die Einsicht in die eigene Ohnmacht manifestierte sich immer stärker: »Meiner Ansicht nach ist das Theater nicht nur scheintot, sondern wirklich gestorben.«
In der Öffentlichkeit genoss Jahnn großes Ansehen: Er wurde erster Präsident der Freien Hamburger Akademie für Künste, und 1956 erhielt er den Lessing-Preis verliehen. »Was ich schreibe, steht nur in Beziehung zu einer Welt, die es nicht gibt, die sich auch nicht formen wird – die ich in Wirklichkeit vor ein paar Jahrtausenden verfehlt habe«, schrieb Jahnn nach seiner Rückkehr aus seinem Bornholmer Exil an den Schriftsteller Werner Helwig.
Dies gilt nicht nur für das gigantische literarische Oeuvre (viele Werke wurden erst posthum veröffentlicht), sondern auch für das dahinterstehende Individuum, für den Skeptiker und Mahner, der 1957 die Thesen gegen die Atomrüstung veröffentlichte. Unmittelbar vor Vollendung des Bühnenstückes ›Der staubige Regenbogen‹, in dem es um apokalyptischen Atomstaub geht, starb Hans Henny Jahnn, das große künstlerische Allroundtalent, der exzentrische und eigenwillige Einzelgänger, der unverstandene Mahner und weitsichtige Prophet am 29. November 1959 in Hamburg kurz vor seinem 65. Geburtstag an den Folgen eines Herzinfarktes.
Äußerst treffend bekannte kürzlich der Jahnn-Biograff Jan Bürger in einem TAZ-Interview: »Wenn jemand konventionelle Maßstäbe und Tabus hinter sich lässt, macht er es seinem Publikum nicht leicht. Jahnns Bücher sind schwierig. Mit ihnen begibt man sich auf Leseabenteuer.«
Titelangaben
Jan Bürger: Der gestrandete Wal
Das maßlose Leben des Hans Henny Jahnn
Hoffmann und Campe Verlag Hamburg 2017
448 Seiten, 34 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander