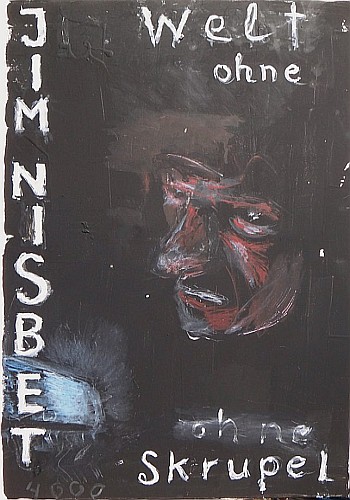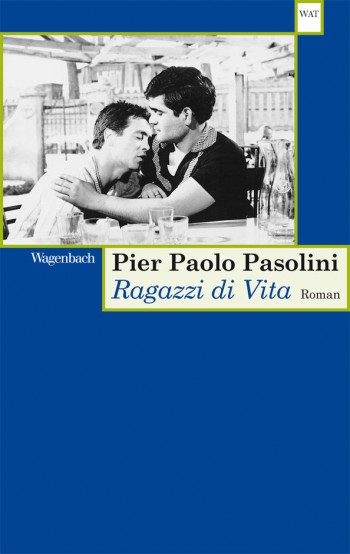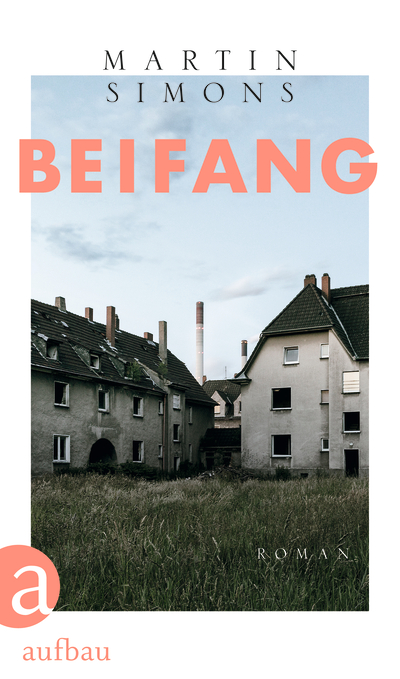Roman | Christopher Ecker: Der Bahnhof von Plön
Christopher Ecker zieht in ›Der Bahnhof‹ von Plön mit schwerem Geschütz auf. Beängstigend konsequent bohrt sich der Kieler Autor in die Abgründe menschlicher Albträume. Der Protagonist, der sich im jüngsten Roman seinen Handlungsspielraum nur mit sich selbst teilen muss, mäandert als eine Mischung aus Superheld, Massenmörder und Oberstudienrat durch Raum und Zeit. VIOLA STOCKER stürzt sich ins Verderben.
 Jemand verfasst seine Memoiren. Christopher Ecker beginnt ›Der Bahnhof von Plön‹ im Bereich des Beliebigen. Memoiren sind für alte Männer und noch auf den ersten eineinhalb Seiten belässt der Autor seine Leser im harmlosen Stillleben eines Kindes mit Hamster. Das gefällige und abgedroschene Bild eines Lebens im Hamsterrad steht in starkem Kontrast zum Rest des Werks. Selbiger ist von einem bildgewaltigen, cineastischen Stil geprägt.
Jemand verfasst seine Memoiren. Christopher Ecker beginnt ›Der Bahnhof von Plön‹ im Bereich des Beliebigen. Memoiren sind für alte Männer und noch auf den ersten eineinhalb Seiten belässt der Autor seine Leser im harmlosen Stillleben eines Kindes mit Hamster. Das gefällige und abgedroschene Bild eines Lebens im Hamsterrad steht in starkem Kontrast zum Rest des Werks. Selbiger ist von einem bildgewaltigen, cineastischen Stil geprägt.
Monumentale Gemälde
Zwar überzeugt Ecker seit jeher mit seiner Wortgewalt, diesmal jedoch gliedert er seinen Roman wie ein Regisseur. Vom anfänglichen Fokus auf einen Hamster im Laufrad schwenkt die Kamera im Laufe des Werks auf ein bombastisches Gemälde, dessen Eindrücklichkeit und Beklemmnis zwischen Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel und Peter Paul Rubens wechselt. Sofort wird man in den Bann eines Antihelden gezogen, der versagen muss, scheitert und zum Schlächter wird.
Dabei spielt Ecker mit Metaphern, wie sie aus Agentenromanen, Fantasyepen und kafkaesken Dystopien bekannt sind. Weder aber legt er sich auf ein Genre fest, noch verfolgt er konsequent ein Ziel. Letztendlich endet sein Roman dort, wo er beginnt, oder er findet einen Weg, das Fantastische gegen die Realität zu tauschen oder er stellt ein neues Rätsel. Was ist der Mensch?
Vergangenheit und Zukunft eines Geschlechts
Schließlich bleibt der Autor im Vagen. Ein Held, nicht näher benannt, benimmt sich wie ein Geheimagent, ein Auftragskiller, der für obskure Personen, denen er sich verpflichtet fühlt, Aufträge ausführt, die sinnlos sind. Tötet er sein eigen Fleisch und Blut? Der Auftraggeber, »Lotse« genannt, führt den Protagonisten wie eine Marionette an Fäden durch die Handlung, die zwischen ekelerregend und fantastisch schwankt.
Dabei bedient sich Ecker gekonnt aus vielen Genres, wobei die einzelnen Schilderungen überaus plastisch geraten. Die Aufgaben, die der Antiheld bewältigen muss, gleichen denen der griechischen Sagen oder des nordischen Sagenkreises. Wie Beowulf, der sein eigenes Monstrum gebiert, schleppt der Held, der sich als Prinz eines niedergehenden Geschlechts entpuppt, die verwesenden Leichen seiner mörderischen Aufträge von einem Stockwerk ins andere.
Ein Konglomerat der menschlichen Erinnerungen
Zeitweise wähnt man sich bei »Game of Thrones«, ein andermal bei ›James Bond‹ oder dem ›Herr der Ringe‹. Ein Prinz, begleitet von einem trollähnlichen, treuen Diener, reist durch die Zeit, um den Untergang seines Geschlechts zu verhindern. Geführt von seinen Feinden, die ihm seine ureigene Begabung, nämlich durch Zeit und Raum zu gleiten, entreißen wollen.
Was macht ein Held, der zwischen Trollen, Zauberern und untreuen Vasallen kämpft, um sich selbst zu retten? Was hat eine Wohnung in New York, unterkellert mit magischen Katakomben, mit dem Bahnhof von Plön zu tun? Es ist eine Rundreise, angestachelt von Eckers Fantasie, die an den archäologischen Entdeckungen des Plöner Sees beginnt, die Gedanken parallel zu unserer eigenen Menschheitsgeschichte weiterspinnt und in der Jetztzeit eines Kieler Gymnasiums endet.
Karikatur des Übermenschlichen
Letztendlich wird der Antiheld auf einem Parforceritt durch die menschliche Entwicklungs- und Kulturgeschichte begleitet. Mündliche Überlieferungen und magische Verwicklungen spielen dabei eine große Rolle. Ebenso die endlosen Fragen nach der Zukunft der Menschheit und der Kapazität menschlichen Denkvermögens. Ecker beantwortet sie mit einem sarkastischen Schmunzeln.
Denn wenn ein zeit- und raumreisender, übermenschlicher Prinz eines aussterbenden, magischen Zauberergeschlechts, dessen Diener Trolle und Magier sind, den unsagbaren Qualen der Folter unterzogen wird, infolge derer er die überragenden Fähigkeiten seines Geistes verliert, entsteht daraus – oh Wunder – ein Oberstudienrat für Deutsch und Philosophie. Was also ist der Mensch?
Titelangaben
Christopher Ecker: Der Bahnhof von Plön
Halle: Mitteldeutscher Verlag 2016
400 Seiten. 22,95 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander