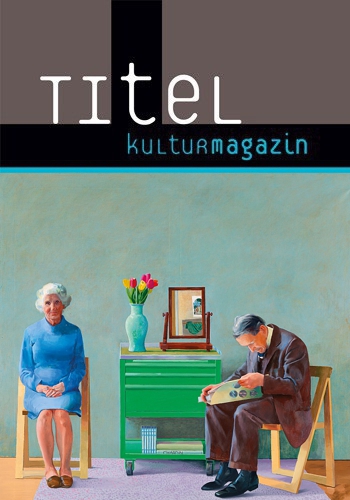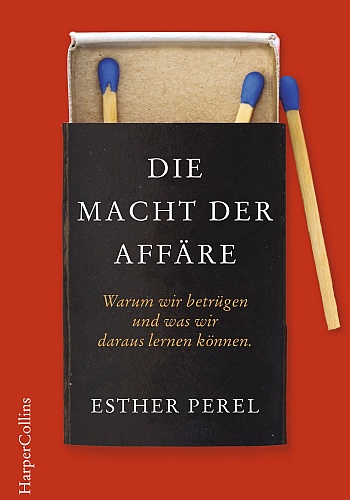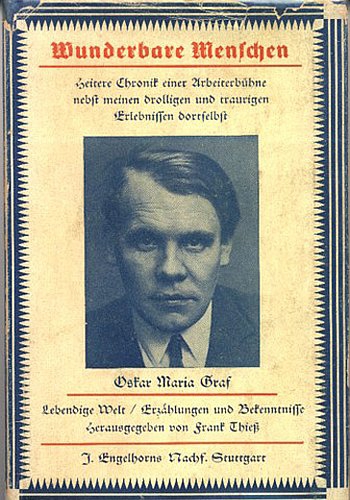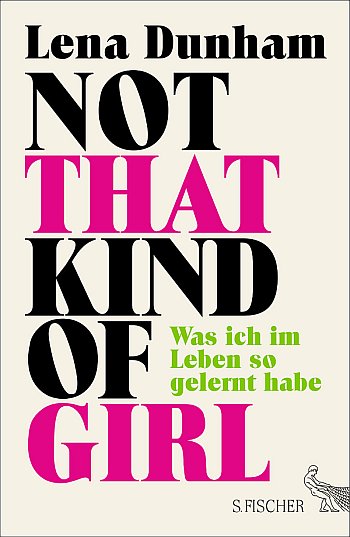Sachbücher | Literatur zu Nietzsche
Leben, Werk und Rezeption Friedrich Nietzsches im Spiegel neuerer Literatur. Vorgestellt von DIETER KALTWASSER
Die zehn Jahre in Nietzsches Leben zwischen seiner Entlassung aus Krankheitsgründen von seinem Lehramt als Philologieprofessor in Basel um 1879 und dem Ausbruch seiner Geisteskrankheit im Januar 1889 waren rar an äußeren Ereignissen. Die einzige ständige Begleiterin seines stetigen Wanderlebens zwischen Meer und Hochgebirge war die Krankheit. Erwin Rohde, ein Freund aus frühen Tagen, fasst seine letzte Begegnung mit Nietzsche in den Worten zusammen: »Eine unbeschreibliche Atmosphäre der Fremdheit, etwas mir damals völlig Unheimliches umgab ihn. Als käme er aus einem Land, wo sonst Niemand wohnt.«
 Im Sommer 1888 entstand in Sils Maria auf dem Hintergrund des Großprojekts einer »Umwertung aller Werte« die »Götzen-Dämmerung«, Nietzsches »große Kriegserklärung« an all das, was bislang für wahr gehalten wurde. Er begrub damit auch seinen ›Willen zur Macht‹, wie Heinrich Meier in seinem Buch ›Nietzsches Vermächtnis‹ betont und sich Interpretationen der beiden zuletzt entstandenen Schriften ›Ecce Homo‹ und der ›Der Antichrist‹ widmet.
Im Sommer 1888 entstand in Sils Maria auf dem Hintergrund des Großprojekts einer »Umwertung aller Werte« die »Götzen-Dämmerung«, Nietzsches »große Kriegserklärung« an all das, was bislang für wahr gehalten wurde. Er begrub damit auch seinen ›Willen zur Macht‹, wie Heinrich Meier in seinem Buch ›Nietzsches Vermächtnis‹ betont und sich Interpretationen der beiden zuletzt entstandenen Schriften ›Ecce Homo‹ und der ›Der Antichrist‹ widmet.
Im September 1888 quartierte Nietzsche sich über den Winter in Turin ein, wo er beide Werke abschloss. Meiers Buch versucht Antworten darauf zu finden, was ein Philosoph ist und was ein philosophisches Leben ausmacht. Nietzsche verhandle in seinem »Zweigespann« das Verhältnis zwischen Natur und Politik sowie der »Selbstverständigung«, die er in seinem Werk ›Also sprach Zarathustra‹ erreicht hatte. Er sieht in beiden Schriften, die in ihrer Zusammengehörigkeit bislang nicht erkannt worden seien, das späte Hauptwerk, das an die Stelle des verworfenen ›Willens zur Macht‹ trete. Meier gelingt es, neue Perspektiven auf Nietzsches Denken zu werfen und an seine Deutungen von ›Also sprach Zarathustra‹ anzubinden.
Als Nietzsche im Januar 1889 in Turin ein misshandeltes Droschkenpferd umarmte, holte ihn Franz Overbeck ab und reiste mit dem brombetäubten Freund über die Alpen in eine Basler Irrenanstalt. Zwölf Jahre später, am 25. August 1900, nach Aufenthalten in Jena und Naumburg, starb Nietzsche, gelähmt und geisteskrank, von seiner Schwester Elisabeth gepflegt und ausgewählten Besuchern im weißen Gewand vorgeführt, 55jährig in Weimar. Sein letztes Wort sei, so die Legende, »Elisabeth« gewesen. Ein einsamer Weg der Philosophie war an sein Ende gelangt.
Mehr Gerücht als Mensch ist die Nietzsche-Schwester bislang gewesen. Doch der Status, den Nietzsche hat, ist in zu nicht geringen Teilen ihr Verdienst. Sie wurde 1846 im Pfarrhaus zu Röcken geboren. Ab den 1890 Jahren gab die Schwester die Texte des Bruders heraus und veranlasste zahlreiche Übersetzungen in andere Sprachen. Sie war 1893 nach dem Tode ihres Ehemanns Bernhard Förster, einem ehemaligen deutschnationalen und antisemitischen Gymnasiallehrer, aus Paraguay nach Naumburg zurückgekehrt.
In seinem detailreichen Buch: »Der Kampf um Nietzsche« belegt Nils Fiebig anhand zahlreicher Beispiele, wie sich Förster-Nietzsche durch die Gunst der Umstände eine unantastbare Rolle als Gralshüterin des Nietzsche-Kults erwarb. In dem von ihr begründeten Nietzsche-Archiv herrschte sie autokratisch über den literarischen Nachlass ihres Bruders.
Erst Rudolf Steiner machte ihre »mangelnde Integrität und mangelhaften philologischen Kenntnisse« Anfang 1900 öffentlich. Mit Verleumdungen wehrte sie sich gegen ihre Kritiker. Wegen ihres ambivalenten Verhaltens und »subjektiven Rechtsempfindens« verstrickte sie sich in zahlreiche und aufwendige Gerichtsprozesse.
 Der »Kampf um Nietzsche« entwickelte sich zu einer medialen Diffamierungskampagne der Hauptbeteiligten. Förster-Nietzsche zögerte nicht, die antisemitische Karte gegen einen ihrer Gegner auszuspielen. Sie sicherte sie sich zudem die Urheberrechte für die Nachlasskompilation des ›Willens zur Macht‹.
Der »Kampf um Nietzsche« entwickelte sich zu einer medialen Diffamierungskampagne der Hauptbeteiligten. Förster-Nietzsche zögerte nicht, die antisemitische Karte gegen einen ihrer Gegner auszuspielen. Sie sicherte sie sich zudem die Urheberrechte für die Nachlasskompilation des ›Willens zur Macht‹.
Die nationalsozialistische Verzerrung des Begriffs »Übermensch«, der bei Nietzsche auf radikalaufklärerische Vorstellungen vom überlegenen Menschen verweist, ist dem späteren Anbändeln der Schwester an den Nationalsozialismus anzulasten. Lange bevor sie als Weimarer Gralshüterin Hitler die Hand reichte, hatte Nietzsche seine Schwester bereits als eine »rachsüchtige antisemitische Gans« bezeichnet.
 Der Historiker Ulrich Sieg hat mit einer lesenswerten Biographie ›Die Macht des Willens‹ einer Reihe bislang unbekannter Dokumente entdeckt, die Elisabeth Förster-Nietzsche als eine Frau zeigen, die zu ihrer Zeit ihren Ehrgeiz nur in der Rolle der Schwester ausleben konnte. Er schildert eindrucksvoll, wie erfolgreich den Nachlass des Philosophen publizierte, wobei sie allerdings vor Fälschungen nicht zurückschreckte. In unterschiedlichen Perioden deutscher Geschichte gelang es ihr, nach der Eröffnung des Nietzsche-Archivs 1894, Nietzsche einer breiten Leserschaft zuzuführen.
Der Historiker Ulrich Sieg hat mit einer lesenswerten Biographie ›Die Macht des Willens‹ einer Reihe bislang unbekannter Dokumente entdeckt, die Elisabeth Förster-Nietzsche als eine Frau zeigen, die zu ihrer Zeit ihren Ehrgeiz nur in der Rolle der Schwester ausleben konnte. Er schildert eindrucksvoll, wie erfolgreich den Nachlass des Philosophen publizierte, wobei sie allerdings vor Fälschungen nicht zurückschreckte. In unterschiedlichen Perioden deutscher Geschichte gelang es ihr, nach der Eröffnung des Nietzsche-Archivs 1894, Nietzsche einer breiten Leserschaft zuzuführen.
Nietzsches Glorifizierung durch die Schwester passte besonders gut zum Nationalsozialismus und wurde von diesem adaptiert. Erst nach 1945 ebbte der Bedarf nach einem »heroischen Nietzsche« endgültig ab, zehn Jahre nach dem Tod Elisabeth Förster-Nietzsches.
Titelangaben
Nils Fiebig: Der Kampf um Nietzsche
Weimar Weimarer Verlagsgesellschaft 2018
288 Seiten, 36 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Heinrich Meier: Nietzsches Vermächtnis
Ecce homo und der Antichrist
München: C.H. Beck, 2019
351 Seiten, 28 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
| Leseprobe
Ulrich Sieg: Die Macht des Willens
Elisabeth Förster-Nietzsche und ihre Welt
Hanser: Berlin 2019
430 Seiten, 26 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
| Leseprobe