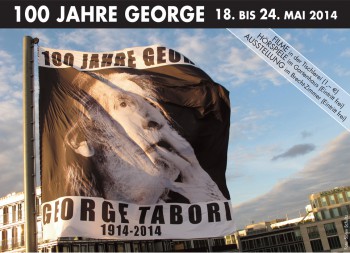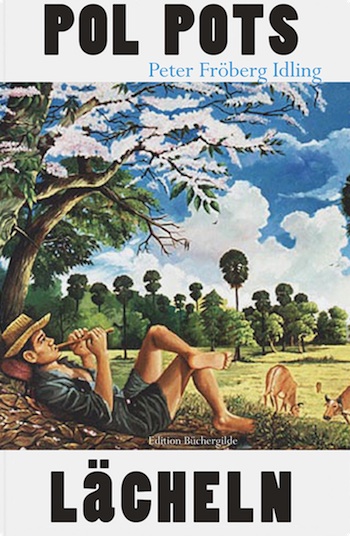Zum 80. Geburtstag der Schriftstellerin Monika Maron (am 3. Juni*) erschien der Essayband ›Was ist eigentlich los‹. Von PETER MOHR
 »Ich bin also verrückt, krank, leide an Transzendenzmangel und gehöre gelegentlich auch zu den Leugnern«, schreibt Monika Maron in ihrem jüngst erschienenen Essayband ›Was ist eigentlich los‹ über ein diffuses Gefühl, das sich bei ihr während der Zeitungslektüre oft einstellte. Harsche Medienkritik, das Ablehnen der Asylpolitik der Merkel-Regierung und eine mehr oder weniger offen formulierte Islamfeindlichkeit ziehen sich wie ein roter Faden durch die jüngeren Arbeiten des neuen Bandes.
»Ich bin also verrückt, krank, leide an Transzendenzmangel und gehöre gelegentlich auch zu den Leugnern«, schreibt Monika Maron in ihrem jüngst erschienenen Essayband ›Was ist eigentlich los‹ über ein diffuses Gefühl, das sich bei ihr während der Zeitungslektüre oft einstellte. Harsche Medienkritik, das Ablehnen der Asylpolitik der Merkel-Regierung und eine mehr oder weniger offen formulierte Islamfeindlichkeit ziehen sich wie ein roter Faden durch die jüngeren Arbeiten des neuen Bandes.
In den letzten Jahren hat sich Monika Maron, die ein Jahr vor der Wende aus der DDR in den Westen übergesiedelt war, politisch mehr und mehr auf den rechten Rand zu bewegt und allerlei krude Gedanken über Ängste und Sorgen »besorgter Bürger« zu Papier gebracht.
In ihrem im letzten Jahr erschienenen Roman ›Artur Lanz‹ bediente Maron auf künstlerisch mäßigem Niveau all die Klischees, die durch die Corona-Krise noch verstärkt wurden: Klagen über vermeintliche Deutungshoheiten des politischen Establishments und seiner Gefolgsleute in den Leitmedien, von einer »Meinungsdiktatur« ist die Rede, und pathetische Wehklagen über Verluste fragwürdiger Heldenfiguren werden angestimmt (»Wir hatten kein Bild mehr von einem Helden, schon das Wort war verdorben«). Im Herbst des letzten Jahres war es zum Bruch zwischen der Autorin und dem S. Fischer Verlag gekommen, der fast alle ihre Bücher veröffentlicht hatte, aber ihre jüngsten politisch-gesellschaftlichen Statements für unvereinbar mit dem Leitbild des Traditionsverlages ansah.
Als Stieftochter des Innenministers hatte Monika Maron in der ehemaligen DDR zunächst beste Karrierevoraussetzungen. Doch nach ihrem nicht ganz freiwilligen Engagement in der FDJ, einem Jahr Arbeit als Fräserin, einem Studium der Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften und einem kurzen Intermezzo als Regieassistentin beim DDR-Fernsehen entschied sie sich für eine Existenz außerhalb des reglementierten Systems und wurde Journalistin und Schriftstellerin.
Nachdem sie in ›Flugasche‹ (1981) die Umweltsünden rund um den Bitterfelder Braunkohletagebau angeprangert hatte, war die heute* vor 80 Jahren in Berlin geborene Autorin rasch zu einer Art Persona non grata geworden, und auch ihr zweiter Roman ›Die Überläuferin‹ (1986) konnte im Osten Deutschlands erst nach der »Wende« erscheinen. Die im Westen gefeierte Autorin Monika Maron war für die DDR nicht mehr tragbar, und so wurde ihr 1988 die Ausreise in die Bundesrepublik gestattet.
»Natürlich kann ich nicht sagen, mein Leben fängt erst 1990 an, aber es ordnet sich um einen anderen Mittelpunkt, und die Fragen stellen sich anders. Ich hätte ›Pawels Briefe‹ nicht schreiben können, solange es die DDR noch gab«, bekennt die Schriftstellerin Monika Maron, die im Rückblick auf ihr eigenes Leben von einer »gemischten Biografie« spricht. Deutsch-deutsche Grenzgänge im geografischen wie im politischen Sinn spiegeln sich nachhaltig in Leben und Werk der Kleist- und Hölderlin-Preisträgerin.
Anders als viele ihrer Weggefährten hat sich die im Berliner Stadtteil Schöneberg lebende Autorin allerdings nicht ideologisch vereinnahmen und zur pauschalen Abrechnung mit der DDR oder zu einer unreflektierten Sozialismusschelte hinreißen lassen. Die künstlerische Auseinandersetzung mit ihrer »gemischten Biografie« setzte sich auch nach dem Mauerfall fort – mit den Romanen ›Stille Zeile sechs‹ (1991) und ›Pawels Briefe‹ (1999), die trotz ihres autobiografischen Fundaments exemplarischen Charakter für die in der DDR aufgewachsene Generation der »Kriegskinder« hatten.
Ihre besten Werke gelangen Monika Maron, die mit dem Deutschen Nationalpreis (2009) und dem Lessing-Preis (2011) ausgezeichnet worden ist, wenn sie sich der Fesseln der eigenen Vita und der deutsch-deutschen Politik entledigte und tief in das Innere ihrer Figuren blickte. In ›Animal triste‹ (1996) erzählt sie auf eindrucksvolle Weise von der unglücklichen Liebe einer Paläontologin, die das Bewusstsein verliert und in einem komatösen Zustand den eigenen Tod vor Augen hat.
Mit dem Problem des Älterwerdens setzte sie sich auch in den späteren Romanen ›Endmoränen‹ (2002), ›Ach Glück‹ (2007) und ›Zwischenspiel‹ (2013) auseinander.
Mit der positiveren Grundstimmung ihrer Hauptfigur Johanna Märtin hat sich in ›Ach Glück‹ auch Monika Marons Tonfall gegenüber ›Endmoränen‹ verändert. Die Sätze scheinen ihr flüssiger aus der Feder geflossen zu sein, dem Phänomen des Alterns begegnete sie mit einem Augenzwinkern.
Am Ende bleibt die spannende Frage: Was hat zur ideologischen 180-Grad-Wende bei Monika Maron geführt? Was hat sie in die Arme der neuen Rechten getrieben und sie zu eine der lautstärksten Spalterinnen in unserer Gesellschaft werden lassen? Und – analog zum Titel ihres Essaybandes – fragt man sich einigermaßen bestürzt: Was ist mit der fraglos verdienstvollen, bedeutenden Schriftstellerin Monika Maron los?
Titelangaben
Monika Maron: Was ist eigentlich los
Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag 2021
192 Seiten, 22 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander