Mit ihrem aktuellen Roman Daheim bekräftigt die Berliner Autorin Judith Hermann – einst euphorisch als Shooting-Star der neuen deutschen Literatur gefeiert – ihren Ruf als große zeitgenössische Erzählerin. Das Beschwören von traumhaften Zwischenwelten und trügerischen Erinnerungen versetzt den Leser in einen beinahe hypnotischen Zustand. Bis die Falle zuschnappt. Von INGEBORG JAISER
 Wie schafft sie das nur, diesen Hauch des Ungewissen, Ungefähren? Diesen lakonischen, ruhigen Ton, hinter dem man doch Unerhörtes vermutet, das einen tagelang umtreiben kann? Als Judith Hermanns Erstlingswerk Sommerhaus, später 1998 erschien, schlug es in der deutschen Literaturlandschaft ein wie eine Naturgewalt. Eine neue Stimme, ein ungeahnter Sound waren geboren, als ob einer ganzen Generation endlich ein angemessener Ausdruck verliehen worden wäre.
Wie schafft sie das nur, diesen Hauch des Ungewissen, Ungefähren? Diesen lakonischen, ruhigen Ton, hinter dem man doch Unerhörtes vermutet, das einen tagelang umtreiben kann? Als Judith Hermanns Erstlingswerk Sommerhaus, später 1998 erschien, schlug es in der deutschen Literaturlandschaft ein wie eine Naturgewalt. Eine neue Stimme, ein ungeahnter Sound waren geboren, als ob einer ganzen Generation endlich ein angemessener Ausdruck verliehen worden wäre.
Doch auch die scheinbar Unbehausten und Unentschlossenen sind älter geworden. Heirat, Kinder, Scheidung – und immer noch kein Plan? Dank der entwurzelten Hauptfigur aus Judith Hermanns neuem Roman wirkt Daheim wie eine schlafwandlerische Fortschreibung von Sommerhaus, später. Die unergründliche Sehnsucht mündet hier in einem eigenen Haus an der nördlichen Küste, dörflich, abgeschieden und nur bedingt romantisch. Dorthin hat es die namenlose Ich-Erzählerin verschlagen, mit Ende 40 fast schon jenseits der Midlife-Crisis, doch nach dem Auszug der erwachsenen Tochter Ann und der Trennung von Ehemann Otis ratlos aus der Bahn geworfen. Es ist ein trockener, vom Ostwind zerzauster Landstrich mit wortkargen Bewohnern, die sich stoisch den Gegebenheiten stellen. Darunter Bruder Sascha, in dessen Hafenkneipe namens Shell die Protagonistin ohne große Ambitionen jobbt.
Schweinezucht und Marderfallen
Von hier aus entwickelt sich ein fein gewobenes Gespinst an diffusen Beziehungen, die aus einem skurrilen Figurenarsenal schöpfen. Vom etwas tumben, liebeskranken Sascha zu dessen durchtriebener Kindsbraut Nike, mit möglicherweise nur vorgespielter Missbrauchs- und Verwahrlosungsvergangenheit. Von der zupackenden Nachbarin Mimi zu deren Bruder Arild, einem einsilbigen Schweinebauern und klarem Mann der Tat, »die Schultern hochgezogen, breitbeinig, den Blick nach unten gerichtet, reizbar und stur, eine massive Kraft, die sich in Brust und Oberarmen zu konzentrieren scheint.« Er ist es auch, der kurzerhand eine Marderfalle im von Tiergeräuschen heimgesuchten Haus der Ich-Erzählerin aufstellt. Im übertragenen Sinne beißt sie dann selbst an, durchsteht eine absonderliche Essenseinladung mit Tiefkühlkost und registriert nach der ersten Liebesnacht mit fast animalischer Aura: »Meine Handgelenke riechen schwach nach Sperma, Aftershave und Ammoniak.«
Zwischen all den verwirrenden Erlebnissen schreibt sie kurze Briefe an ihren Ex-Mann Otis, einer schillernden Figur zwischen Messie und visionärem Sammler, der gegen den nahen Weltuntergang ankämpft. Ihr lapidares Bekenntnis: »Wir haben uns scheiden lassen, damit ich im Falle seines Todes nicht zwangsverpflichtet bin, mich um sein Archiv zu kümmern.« Dem Wunsch nach absoluter Reduktion ist auch Tochter Ann nachgekommen, die sich irgendwo auf die Weltmeere abgesetzt hat und in sehr unzuverlässigen Abständen lediglich ihre aktuellen Koordinaten durchgibt.
Die Erfindung der Einsamkeit
In der sparsamen Kommunikation mit ihrer zerbrochenen Familie lebt ein frühes Kapitel aus dem Leben der Ich-Erzählerin wieder auf. Als sehr junge Frau hat sie in einer kargen Einraumwohnung gelebt und in einer Zigarettenfabrik gejobbt (eine charmante Reminiszenz an all die rauchenden Protagonisten der restlichen Hermann-Stories), bis sie eines Tages von einem dubiosen Zauberer in Schlangenlederschuhen angesprochen wurde, der in ihr die perfekte Partnerin für seinen Trick mit der zersägten Jungfrau sah. Trotz erfolgreicher Probe und Zusage für ein Engagement auf einem Kreuzfahrtschiff nach Singapur, kam es nicht zur großen Reise. Doch das Bild der Kiste bleibt (»einen Moment später dachte ich, ich wäre tatsächlich in zwei Hälften geteilt – nicht körperlich, eher im Kopf. Mein Herz wäre in zwei Hälfen geteilt, ich war da, und ich war ganz woanders.«) und setzt sich als durchgehendes Motiv fort: in Fallen, düsteren Räumen, Holzverschlägen.
Dennoch schafft es Judith Hermann, in diesem schmalen, kaum 200 Seiten umfassenden Roman durch viele Leerstellen und Freiräume eine traumhafte Stimmung zu erzeugen, einen gelassenen Zustand des Abwartens und sachten Abdriftens, der assoziativen Bezüge. Ein sparsamer, verhaltener, an der Sprache Raymond Carvers geschulter Duktus verbindet sich mit den Topoi des Verschwindens und Sich-Auflösens, wie man sie von Paul Auster kennt. Auch Bilder drängen sich unwillkürlich bei der Lektüre auf: die greifbare Einsamkeit von Edward-Hopper-Gemälden, die harsche Sprödigkeit der Aki-Kaurismäki-Filme.
Unterschwellig schwingen die großen existentiellen Fragen jedes Einzelnen mit. Könnte die komplette Konstruktion eines Lebens auf purer Illusion gründen, wie ein gekonnter Zaubertrick? Oder, wie es Tochter Ann formuliert: »Ihr denkt, ihr hättet eine Bibliothek in euch, eine Sammlung, Bilder und Erinnerungen, die euch zu dem machen, was ihr seid. Gründe für das, was ihr mögt und nicht mögt. Aber diese Bibliothek ist eine Erfindung.«
Titelangaben
Judith Hermann: Daheim
Frankfurt: Fischer 2021
189 Seiten, 21 Euro
| Erwerben Sie diesen Band portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe
| Mehr von Judith Hermann in TITEL kulturmagazin




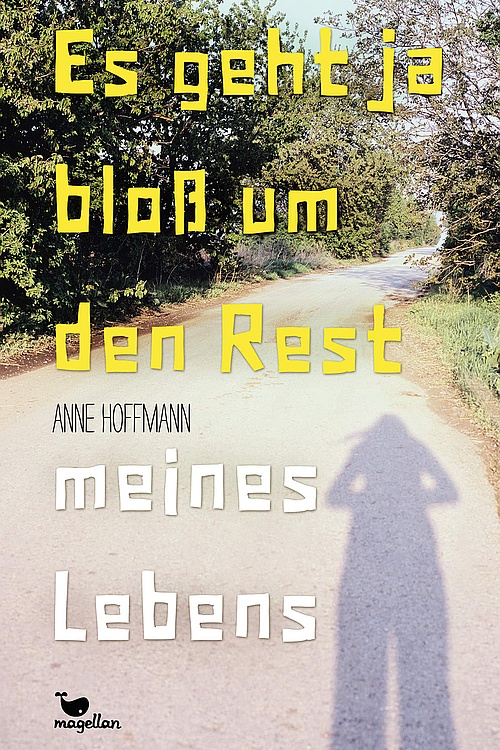
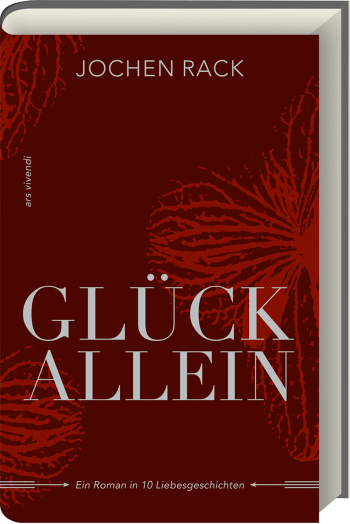

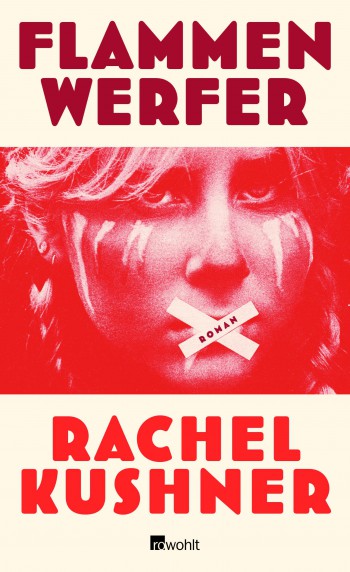

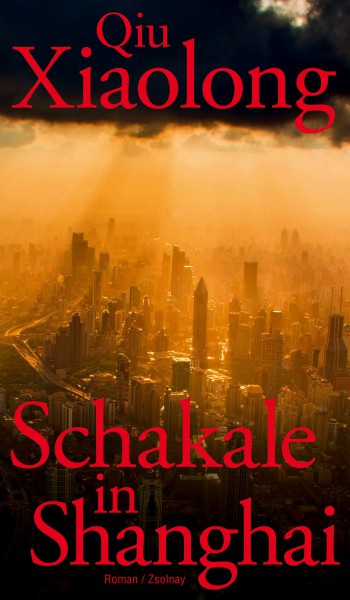

[…] Ingeborg Jaiser sieht im online-Magazin TITEL-kulturmagazin Judith Hermanns Ruf als große zeitgenössische Erzählerin bekräftigt, hier. […]