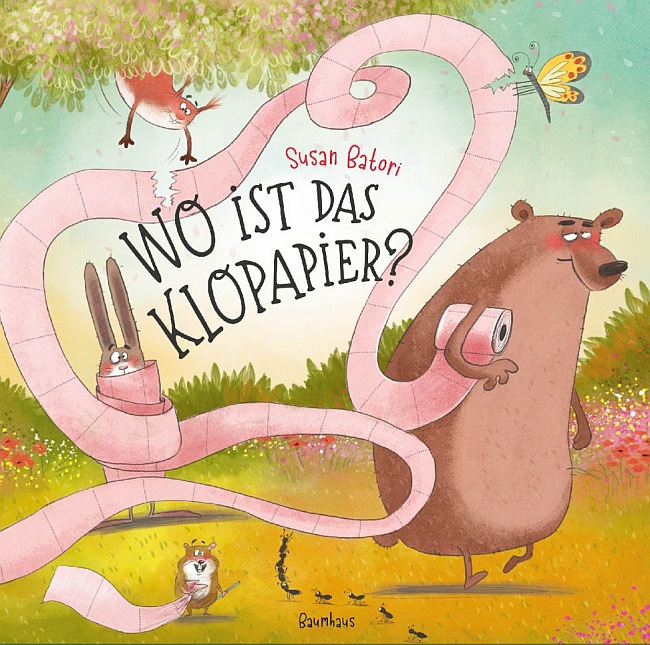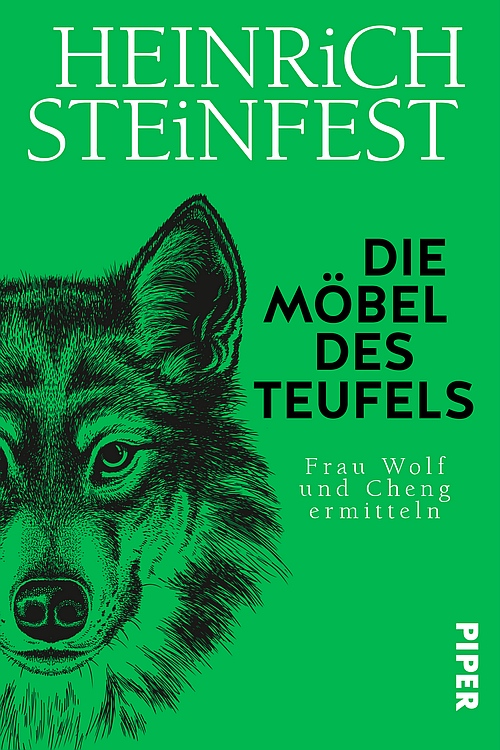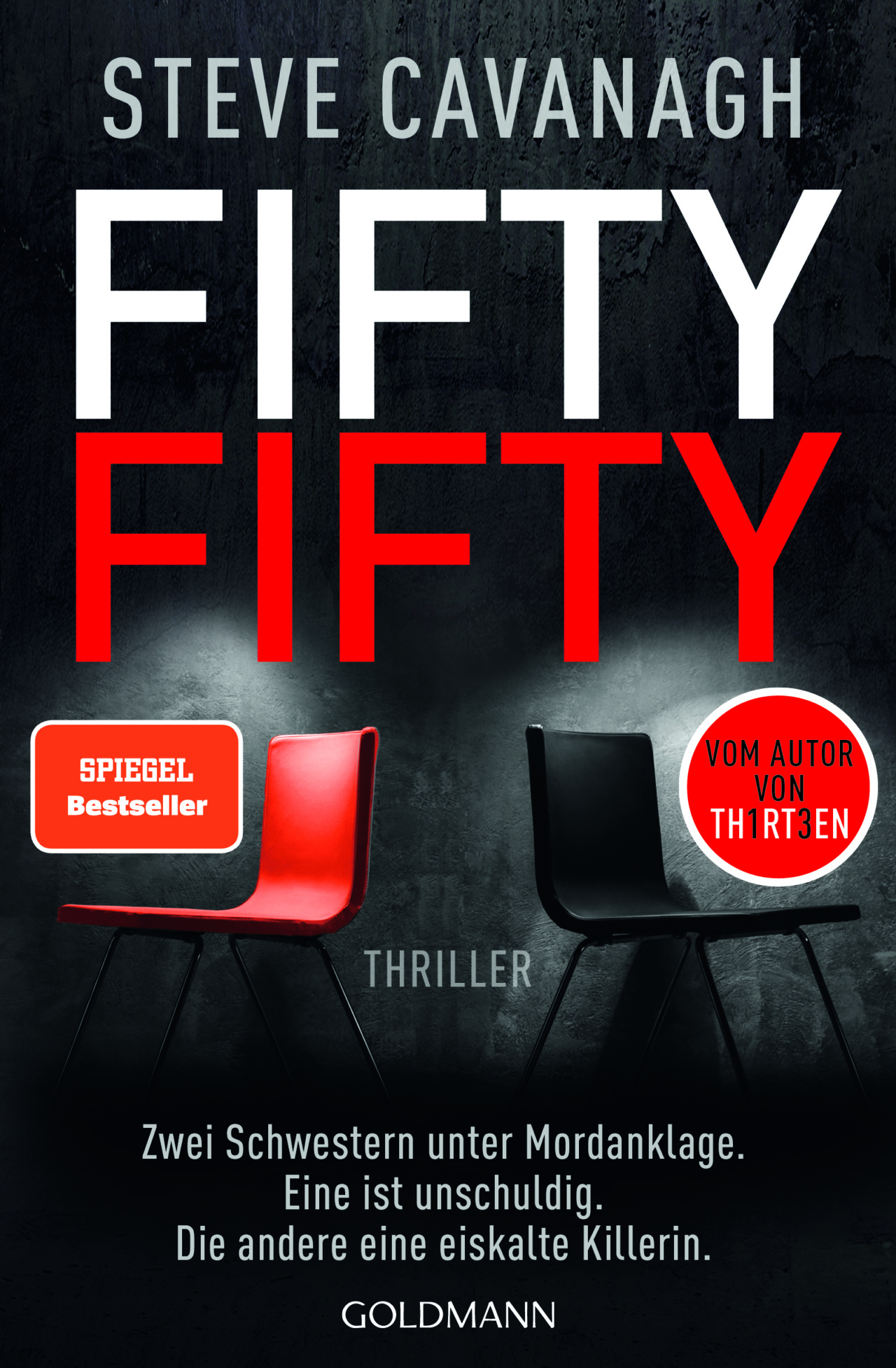»Ich hatte herrlich lange geschlafen und ausgiebig gefrühstückt und setzte mich dann mit meiner Gitarre auf die Treppe, die vom Wintergarten in den Garten führte. Entspannt drehte ich mir eine Morgenzigarette, mischte zwecks Horizonterweiterung ein paar Krümel Gras dazu.« Das sind die selbstverliebt anmutenden Gedanken des Protagonisten aus Klaus Modicks neuem Roman Fahrtwind. Von PETER MOHR
 Modick, der am 3. Mai seinen 70. Geburtstag feierte, gehört seit vielen Jahren als feste Größe zum deutschsprachigen Literaturbetrieb. Als Übersetzer, Essayist, Kritiker und fleißiger Erzähler hat sich der promovierte Literaturwissenschaftler einen Namen gemacht. Zuletzt hatte sich Modick in einer reizvollen Mischung aus Fakten und Fiktion dem baltischen Dichter Eduard von Keyserling (Keyserlings Geheimnis, 2018) und der Worpsweder Künstlerkolonie (Konzert ohne Dichter, 2015) gewidmet.
Modick, der am 3. Mai seinen 70. Geburtstag feierte, gehört seit vielen Jahren als feste Größe zum deutschsprachigen Literaturbetrieb. Als Übersetzer, Essayist, Kritiker und fleißiger Erzähler hat sich der promovierte Literaturwissenschaftler einen Namen gemacht. Zuletzt hatte sich Modick in einer reizvollen Mischung aus Fakten und Fiktion dem baltischen Dichter Eduard von Keyserling (Keyserlings Geheimnis, 2018) und der Worpsweder Künstlerkolonie (Konzert ohne Dichter, 2015) gewidmet.
An diesem bewährten Muster hat der Autor festgehalten und nun Eichendorffs Taugenichts in die frühen 1970er Jahre verfrachtet. Der Protagonist ist ähnlich wie im Original ein Müller-Sohn – mit dem feinen Unterschied, dass es sich in der zeitgenössischen Fassung um den vornamenlosen Sohn eines erfolgreichen Heizungsbau-Unternehmers namens Müller handelt.
»Wie lange sollen wir dich eigentlich noch durchfüttern? Wenn du schon nichts mit der Firma zu tun haben willst, dann sieh wenigstens zu, dass du mir nicht mehr auf der Tasche liegst«, wettert Müller senior gegen seinen antriebslosen Sohn, der sich einzig für die Musik begeistern kann. Mit der Gitarre im Gepäck und angetrieben von einer diffusen Mischung aus Fernweh und Freiheitsdrang zieht er per Anhalter Richtung Süden.
Nicht in der Kutsche wie bei Eichendorff, sondern in einem weißen Mercedes-Cabrio wird er von zwei Damen zur Mitreise eingeladen. Der Fahrtwind weht ihm um den Kopf, alles wirkt etwas irreal – gerade so, als säße ihm Eichendorff als Beobachter im Nacken. Und prompt verliebt sich Müller auch in die »schöne Schlanke«. Über Wien geht es nach Rom, in ein stattliches Landhaus. Er lernt auf seiner Selbstfindungs-Aussteigertour herrlich schräg gezeichnete Figuren kennen. Mit seiner Gitarre, toskanischem Rotwein, handverlesener Ernte aus Hanffeldern und psychedelischen Experimenten mit Giftpilzen (in der zeitgenössischen Literatur bereits von Martin Suter in Die dunkle Seite des Mondes, 2000, ausschweifend beschrieben) genießt die Hauptfigur ihre Freiheit.
Für seine Müller-Figur hat Autor Klaus Modick einen hermetischen Kosmos aus Musik und Poesie geschaffen. Der Protagonist glaubt unbeirrbar an die Kraft der Kunst, die Musik von Bob Dylan und Leonard Cohen flimmert wie ein Soundtrack allgegenwärtig durch die Zeilen. Im Hintergrund tauchen schemenhaft die Nachwehen der Studentenbewegung und die RAF-Verbrechen auf.
Das alles ist handwerklich ausgesprochen gut arrangiert, mit leichter Hand und einem ausgesprochen heiteren Tonfall verfasst, doch Müllers Flucht in den Süden als Gegenentwurf zum Leben in der Heimat funktioniert nicht wirklich. Der authentische Atem der 1970er Jahre will sich bei der Lektüre nicht entfalten. Allenthalben stört das große Vorbild Eichendorffs, nach dessen Pfeife das gesamte Figurenensemble tanzt.
Klaus Modicks Roman Fahrtwind hätte man als federleichtes Sommerbuch lesen können, das mit reichlich mediterranem Feeling ausgestattet ist, als zarte Hymne auf die Hippie-Kultur und offene Liebeserklärung an Italien. Doch diese Freuden werden durch Modicks hochambitionierten Eichendorff-Überbau leider etwas getrübt.
Titelangaben
Klaus Modick: Fahrtwind
Köln: Kiepenheuer und Witsch 2021
196 Seiten. 20.- Euro
| Erwerben Sie diesen Band portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe