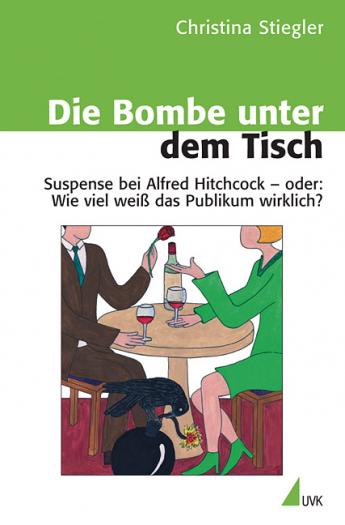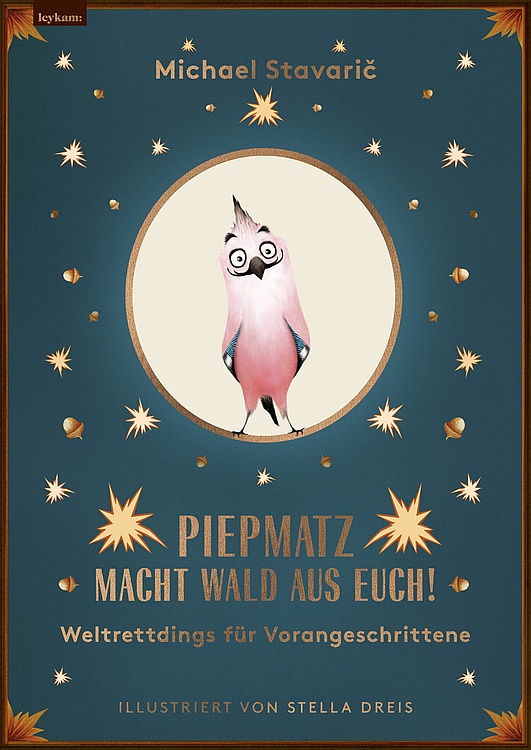Die Vielfalt, mit der uns der Zen-Buddhismus gegenübertritt, ist verwirrend, er ist eine reichhaltige, den Europäern ursprünglich fremde Kultur, auch wenn wir historisch gelegentlich eine Nähe wahrnehmen, etwa in den Predigten von Meister Ekkehart oder bei Johannes vom Kreuz. Andererseits finden wir ihn aktuell weit verbreitet, seine Meister in den westlichen Industrienationen pflegen eine zahlreiche Anhängerschaft, Beat-Poeten wie Allen Ginsberg oder Jack Kerouac und Ikonen des Pop wie Leonard Cohen oder Kate Bush bekennen sich zu Zen, da ist hohe Zeit für einen ordnenden Überblick, wie ihn Michel Dijkstra vorlegt. Von WOLF SENFF
 Zen erschöpft sich ja bei weitem nicht in seinen meditativen Praktiken, sondern er gestaltet eine Kultur; die diversen Budo-Kampfkünste, auch Karate, Wing Chun – ein Kung Fu-Stil, der auf das Shaolin-Kloster zurückgeht – ordnen sich dessen Tradition zu, ebenso die einzigartige chinesische Landschaftsmalerei und das Haiku als eine Form der Poesie; es ist ein ambitioniertes und überfälliges Unterfangen, in dieser Vielfalt eine klare Linie zu ziehen.
Zen erschöpft sich ja bei weitem nicht in seinen meditativen Praktiken, sondern er gestaltet eine Kultur; die diversen Budo-Kampfkünste, auch Karate, Wing Chun – ein Kung Fu-Stil, der auf das Shaolin-Kloster zurückgeht – ordnen sich dessen Tradition zu, ebenso die einzigartige chinesische Landschaftsmalerei und das Haiku als eine Form der Poesie; es ist ein ambitioniertes und überfälliges Unterfangen, in dieser Vielfalt eine klare Linie zu ziehen.
Dijkstra geht historisch vor, er beschreibt die Entwicklung des Zen in China, in Korea, in Japan und in den westlichen Industrienationen.
Als meditative Übung wurde Zen in China entwickelt, er hat seine praktischen Wurzeln, das Sitzen mit gekreuzten Beinen, im indischen Yoga, in dessen Askese und Konzentrationsübungen, in der Anstrengung, der sich der Mensch unterzieht, um eine befreiende Erfahrung zu erleben.
Der Sturz der Han-Dynastie 220 n. Chr. in China ermöglichte früh die Ausbreitung buddhistischer Inhalte, sie fanden nach und nach ihren Platz zwischen einem strengen konfuzianistischen Regelwerk und dem taoistischen Freiheitsdrang und setzten voraus, daß die Buddha-Natur, die es auszubilden gelte, allen Lebewesen zu eigen sei, und mit Bodhidharma tritt im sechsten Jahrhundert der erste in einer Reihe von Patriarchen auf.
Huineng (638-713), der sechste Patriarch, den auch seine Herkunft aus ärmlichen Verhältnissen von seinen Vorgängern unterscheidet, lehnt die dualistische Sicht einer einerseits verunreinigten irdischen Realität und einem andererseits reinen, erleuchteten Zustand ab, die Erleuchtung sei keine pure, unveränderliche Essenz, erreichbar allein durch beharrliche Meditation, sondern ein dynamisches Prinzip, ein ständiges Reinigen und Klären, erleuchtetes Verhalten sei außerdem untrennbar mit der Lebenswirklichkeit verbunden und finde in der Interaktion mit den Menschen statt.
Überliefert ist, daß Huineng in aller Heimlichkeit zum Patriarchen geweiht und wegen seiner isolierten Position gedrängt wurde, das Kloster zu verlassen, und daß er sich fünfzehn Jahre lang verborgen hielt; er habe dann ein südchinesisches Kloster besucht und zwei Mönchen, die darüber stritten, ob eine Fahne durch den Wind bewegt werde oder ob, umgekehrt, es die Fahne sei, die den Wind bewege, entgegnet, es sei einzig ihrer beider Geist, der sich bewege.
Dieses kam dem Abt zu Ohren, und Huineng gab sich als der sechste Patriarch zu erkennen, er unterrichtete in seiner letzten Lebensphase in einigen Klöstern, und die Legende sagt, daß, als er seinen letzten Atemzug tat, die Berge rund um das Kloster eingestürzt seien, die Erde gebebt habe und die Wälder sich weiß eingefärbt hätten.
Huineng war der sechste und letzte chinesische Patriarch, und mit dem siebten Jahrhundert, dem ersten der Tang-Dynastie (618-906), verbreitete sich der Zen-Buddhismus über das gesamte Reich.
Dijkstra schildert sehr anschaulich, er flicht Episoden ein, immer wieder auch Koans, paradoxe Zen-Dialoge, in die der Schüler sich vertieft und die helfen sollen, verkrustete Denkgewohnheiten aufzubrechen, auch in eine knappe Frage gefaßt, etwa: ›Wenn ein Ochsenwagen nicht fahren will, soll man dann den Wagen oder den Ochsen schlagen?‹, schwierig, und Mazu Daoyi (709-788) trug eine Schocktherapie bei, die den Lernprozeß mit Schreien, Schlägen mit Stöcken und bizarren Gesprächen fördern sollte.
Die Realität sei ein Mysterium, das jeden Versuch einer Konzeptualisierung übersteige, und der Buddha-Geist, angelehnt an das Tao der taoistischen Tradition, sei ein alles verbindendes und tragendes Prinzip, die Erleuchtung – dies ein häufig umstrittenes Thema – sei keineswegs nur durch Sitzmeditation, sondern auch durch die einfachsten alltäglichen Handlungen zu erreichen.
Der Zen-Buddhismus mußte sich jedoch zeitweilig gegen mächtige Gegner behaupten, so etwa im neunten Jahrhundert die Linji-Schule gegen einen wachsenden konservativen Neo-Konfuzianismus und gegen die affirmative Reines-Land-Bewegung.
Die Kultur des Zen brachte aber auch bedeutende Künstler hervor, etwa in der Landschaftsmalerei und in der Kalligraphie, im elften Jahrhundert entstand die bedeutende Koan-Sammlung Biyanlu, ›Aufzeichnungen des türkisblauen Felsen‹, und auch die sogenannten Ochsen-Bilder zeigen die Schritte auf dem Weg zur reinen Buddha-Natur.
Letztlich habe der Zen-Buddhismus in China jedoch an Kraft und Ausstrahlung verloren, in der späten Song-Dynastie und der Ming-Dynastie (1368-1644) fänden sich nur wenige bedeutende Vertreter.
Chinesische Missionare trugen den Buddhismus im vierten Jahrhundert nach Korea, wo er sich mit dem dortigen Schamanismus vermischte und während zweier mittelalterlicher Dynastien, den Vereinigten Silla (668-935) und den Goryeo (937-1392), zur Staatsreligion wurde, es entstanden diverse Schulen und wenig anders als in China und Japan heftige Auseinandersetzungen über die Gewichtung von Meditation und das Studium der Schriften.
Durch die enge Bindung an die Dynastien taten sich Korruption und Nepotismus als weiteres Problem auf, auch das Verhältnis von plötzlicher Erleuchtung, Hongaku, und schrittweiser Übung wurde immer wieder neu beschrieben. Mit der Yi-Dynastie erfuhr der Zen-Buddhismus einen drastischen Niedergang, und erst in der Neuzeit entwickelte sich Zen in Südkorea wieder zur bedeutendsten Form des Glaubens.
Ähnlich wie in China habe sich der Zen-Buddhismus in Japan durchsetzen müssen, anfangs befördert vor allem durch Besuche und Studien vor Ort in China, sein erster entschiedener Vertreter war Myoan Eisai (1141-1215), bevor Dogen (1200-1253) als maßgeblicher Pionier auftritt, für den die Sitzmeditation die zentrale Säule des Zen bildet.
Er erweitert das Verständnis von Zen, indem er allen Dingen (nicht nur den Lebewesen) eine Buddha-Natur zuerkennt, die sich ständig manifestiere und die es durch meditative Praxis des Sitzens auszubilden gelte, sogar der Vergänglichkeit hafte Buddha-Natur an, denn auch der Vergänglichkeit könne sich der Mensch öffnen und lernen, daß er mit allem verbunden sei.
Die im Gefolge Dogens entstehende Soto-Schule prägt neben der an Linjis Lehre orientierten Rinzai-Schule die Praxis des Zen und der Kultur in Japan, auch in der Tokugawa-Ära (1603-1867) behielt der Zen-Buddhismus seinen Einfluß auf die japanische Gesellschaft und fand Ausdruck in den Werken großer Künstler wie dem Dichter des siebzehnten Jahrhunderts Basho.
Hakuin (1686-1769) gilt als der letzte große Zen-Meister, den Japan hervorgebracht hat, er belebte die erstarrte Rinzai-Schule, er zweifelte am Effekt der ruhigen Sitzmeditation und systematisierte das Koan-Studium: Alle Lebewesen seien erleuchtet, es gehe allein darum, dieses jeweils auch zu erkennen und zu realisieren.
Die Situation des Zen-Buddhismus in Europa und den USA ist höchst lebendig und unübersichtlich, der Westen allgemein wird jedoch seitens bedeutender Philosophen der japanischen Kyoto-Schule wie Kitaro Nishida (1870-1945) und Keiji Nishitani (1900-1990) aufgrund seiner von Technik und Wissenschaft überfrachteten Zivilisation in einer tiefgreifenden geistigen Krise gesehen.
Michel Dijkstra zeigt in seiner Darstellung, der ein sorgfältiges menschliches Lektorat noch gutgetan hätte, die wesentlichen Traditionslinien des Zen und ihre diversen Ausformungen, sie füllt eine Lücke in der Literatur über Zen und ist sehr zu empfehlen.
Titelangaben
Michel Dijkstra: Zen-Buddhismus. Die Kunst des Loslassens
Aus dem Niederländischen von Michel Keil
Origo Verlag Bern 2024
271 Seiten, 27,90 Euro