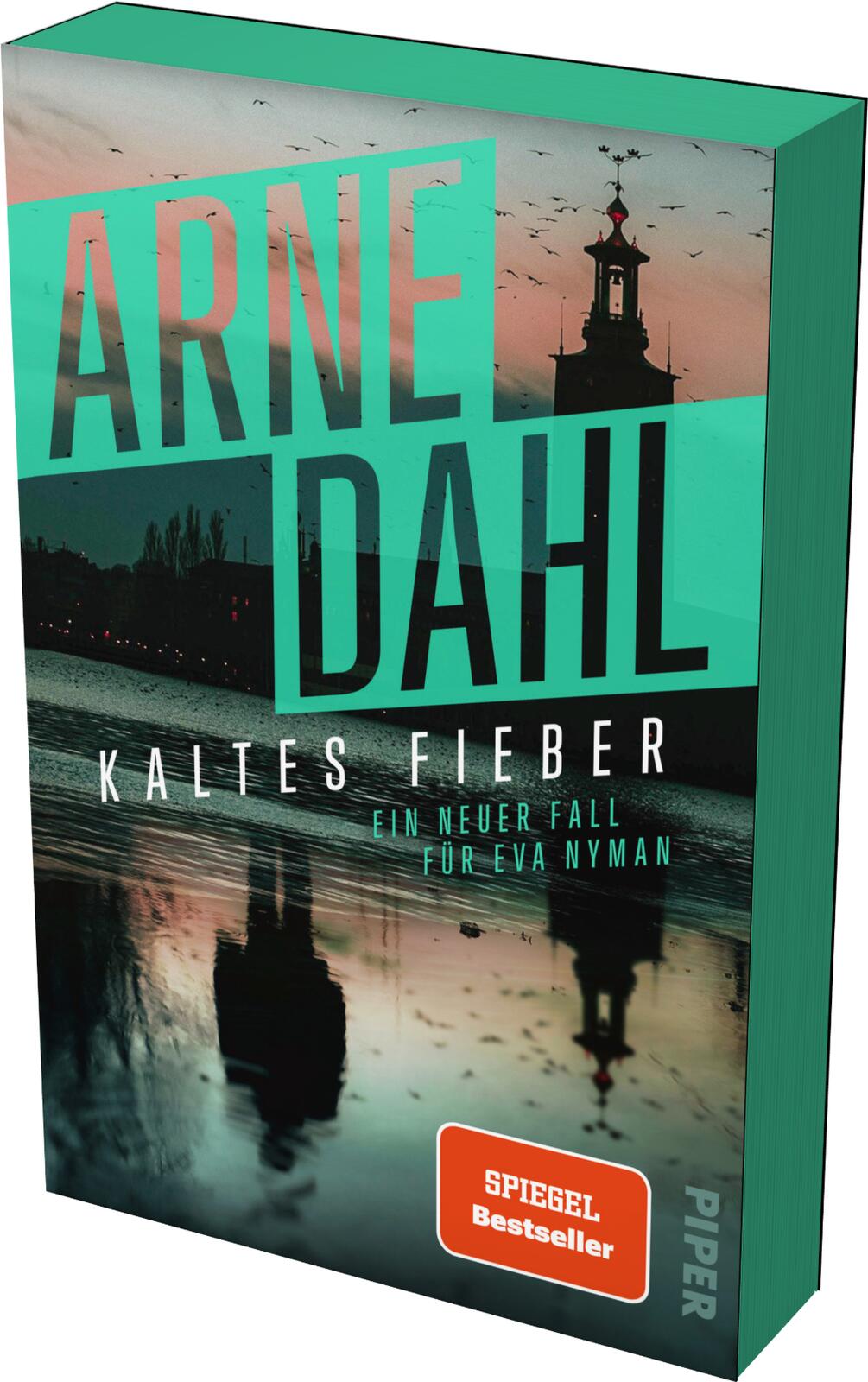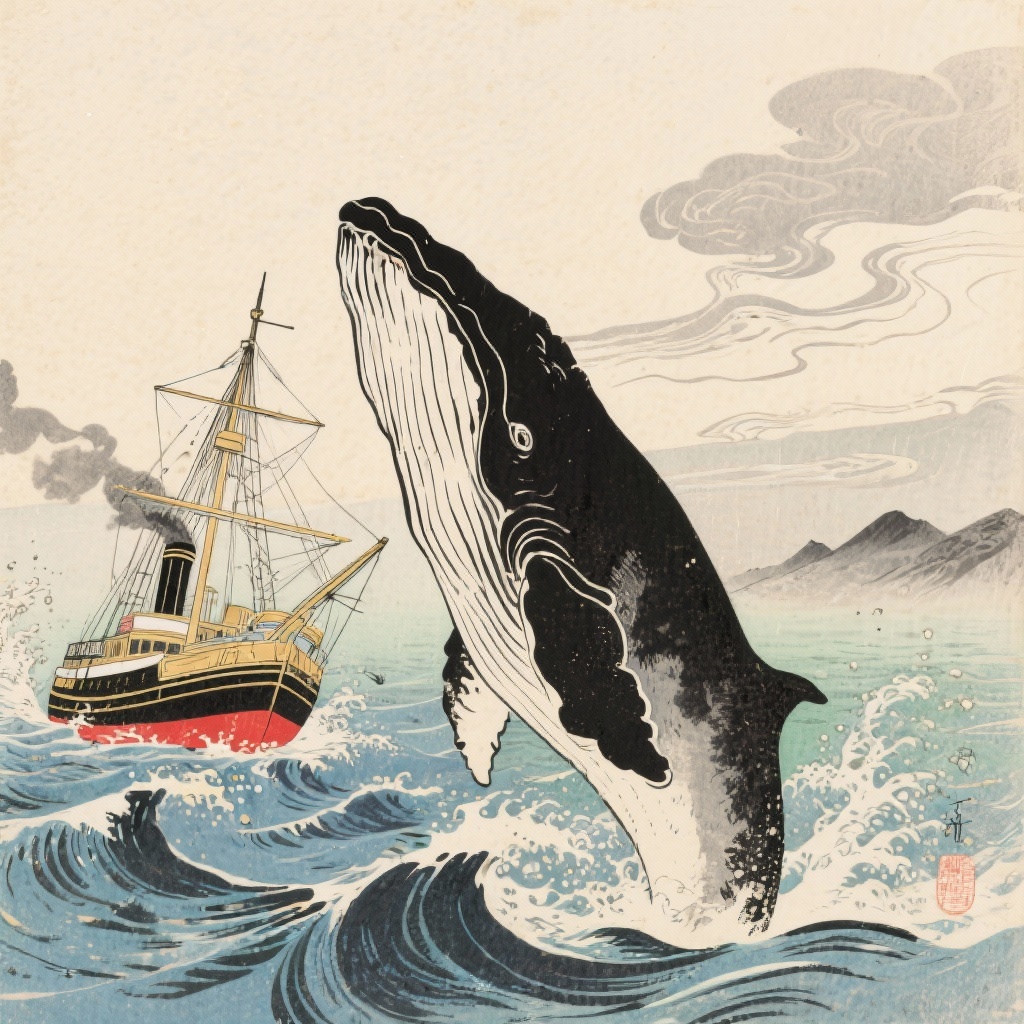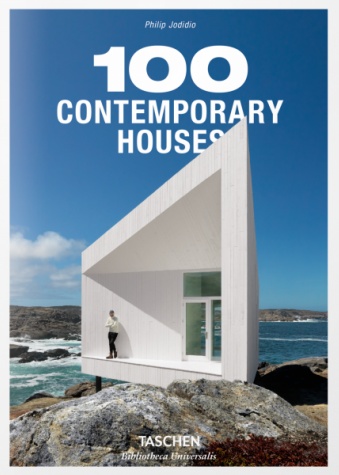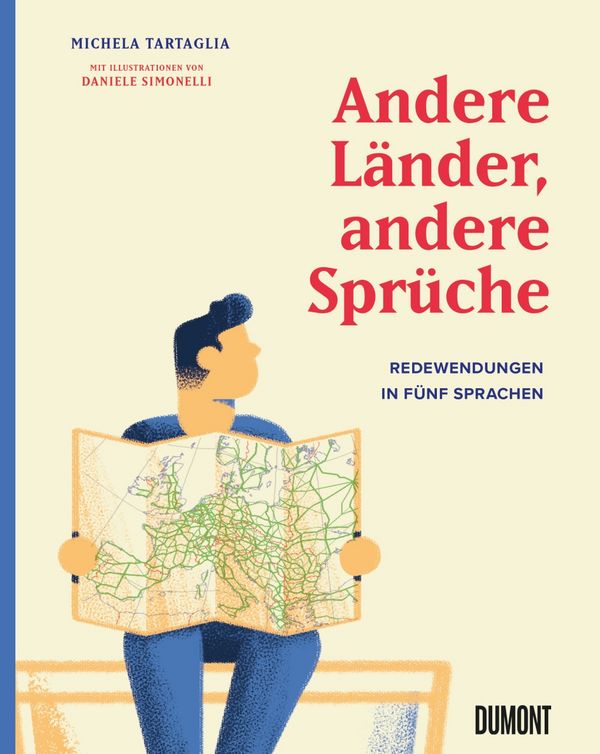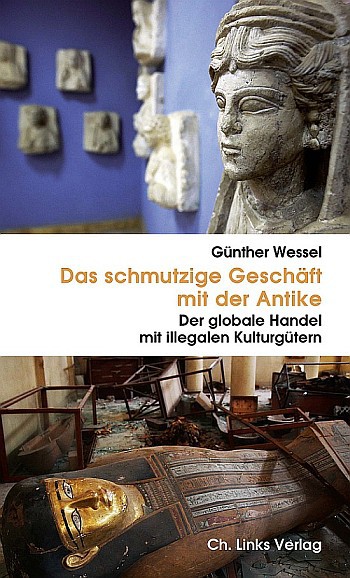Wir treten ihn mit Füssen – nicht nur im wörtlichen, sondern auch im übertragenen Sinne: Dabei stellt der Boden nichts Geringeres dar als unsere Lebensgrundlage. Doch weil er uns so selbstverständlich erscheint, laufen wir achtlos über ihn hinweg und tragen ihm kaum Sorge. Von MARTIN GEISER
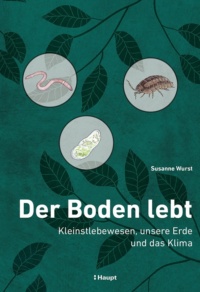 Was Boden eigentlich ist, was in ihm lebt und was dieses Leben bedroht: Das ist der Inhalt des Buchs ›Der Boden lebt‹ von Susanne Wurst, einer ausgewiesenen Expertin für Bodenökologie in Deutschland. Wurst vermittelt darin ihre Faszination für das Erdreich und die schier unvorstellbare Vielfalt und Fülle an Leben, die dort existiert.
Was Boden eigentlich ist, was in ihm lebt und was dieses Leben bedroht: Das ist der Inhalt des Buchs ›Der Boden lebt‹ von Susanne Wurst, einer ausgewiesenen Expertin für Bodenökologie in Deutschland. Wurst vermittelt darin ihre Faszination für das Erdreich und die schier unvorstellbare Vielfalt und Fülle an Leben, die dort existiert.
In diesen Bann mitgezogen wird, wer den Themen Natur und Ökologie nicht vollständig abgeneigt ist. Das Buch dürfte auch für Schüler(innen) spannend sein, die sich mit Bodenbiologie beschäftigen – freiwillig oder im Rahmen des Unterrichts. Wer farbige Fotos oder einen Bildband erwartet, wird enttäuscht: Das Buch setzt ausschliesslich auf schlichte Zeichnungen.
Fantastisch komplexes Zusammenspiel
In einem ersten Teil beschreibt Wurst das Leben im Boden: Von den grossen Tieren wie dem Maulwurf oder den Regenwürmern bis hin zu den Wurzeln der Pflanzen, dann zu immer kleineren Wesen wie Spinnen, Pilzen und Bakterien. Sie alle wirken im Ökosystem Boden in einem unglaublich komplexen und faszinierenden Netzwerk zusammen. Ein Beispiel: Die Wurzeln von Leguminosen – also Hülsenfrüchtlern wie Klee, Soja oder Bohnen – locken mit speziellen Stoffen ganz bestimmte Bakterien an.
Der Hintergrund: Die Pflanze geht mit diesen Bakterien eine enge Kooperation ein, eine Symbiose. Die Bakterien einerseits profitieren von Nährstoffen, die ihnen die Pflanze zur Verfügung stellt. Andererseits nehmen die Bakterien Stickstoff aus der Luft auf – der gesunde Boden ist durchlüftet – und geben ihn der Pflanze in Form von Ammoniak ab. Diesen baut die Pflanze in Aminosäuren ein, die sie unter anderem für ihr Wachstum benötigt.
Sichtbar wird diese Symbiose an den kleinen Knöllchen, die sich an den Wurzeln bilden. Daher heissen die Bakterien auch Knöllchenbakterien oder Rhizobien. Doch nicht nur die direkt an der Symbiose beteiligten Partner profitieren von der Fixierung des Stickstoffs aus der Luft. So können Pflanzenwurzeln, beispielsweise wenn sie absterben, stickstoffhaltige Moleküle in den Boden abgeben. Dort dienen diese als Dünger für andere und folgende Pflanzen. Dieses Prinzip nutzen Landwirte gezielt bei Fruchtfolgen oder Gründüngung.
Zu gering geschätzt und zu wenig geschützt
Die Landwirtschaft führt denn auch ins zweite Kapitel »Funktion«. Dass ohne Boden kaum Nahrungsmittel produziert werden könnten, ist offensichtlich. Aber der gesunde Boden leistet noch viel mehr: Böden binden gewaltige Mengen Kohlenstoff, das ansonsten als CO2 in die Atmosphäre gelangen und den Klimawandel weiter beschleunigen würde.
Insbesondere zu nennen wäre der Moorboden, der speziell viel Kohlenstoff bindet. Er ist ein gewichtiges Beispiel dafür, dass Klimaschutz und Bodenschutz Hand in Hand gehen – und mit den beiden auch der Artenschutz. Der Boden beherbergt nicht nur eine riesige Vielfalt an Leben in der Tiefe, sondern ermöglicht an der Oberfläche eine noch viel grössere: Beinahe das gesamte Leben an Land. Klimaschutz, Artenschutz und Bodenschutz sind also untrennbar – sie bedingen und stärken sich gegenseitig.
All seine Funktionen kann nur gesunder Boden erfüllen. Doch wie der Titel des dritten Kapitels feststellt, ist der »Boden in Gefahr«. Wie und in welchem Ausmass ist für den Laien erschreckend. So bezeichnet die EU-Kommission zwei Drittel des Bodens als »nicht gesund«. Dafür trägt nicht zuletzt die Landwirtschaft Verantwortung. Wenn beispielsweise schwere Maschinen den zu feuchten Boden befahren, wird er dadurch verdichtet, was seine Funktionen dauerhaft beeinträchtigt. Oder der Einsatz von Pestiziden tötet oft nicht nur die eine unerwünschte Art, sondern schädigt ganze Lebensgemeinschaften – oft für Jahre. Dabei würde die Landwirtschaft mit stabilen Erträgen selber von gesunden und damit widerstandsfähigen Böden profitieren.
Wer denkt an die Zukunft?
Doch, das zeigt schliesslich das vierte Kapitel »Schutz«, die Verantwortung liegt nicht allein bei der Landwirtschaft: Auch unser zunehmender Platzbedarf für immer grössere Wohnungen und breitere Strassen frisst den Boden buchstäblich auf. Zudem entscheidet unsere Ernährung darüber, was auf den Feldern wächst. Geradezu ein Desaster ist, dass grosse Mengen an Nahrungsmitteln weggeworfen werden, die zuvor mit viel Aufwand auf unseren Böden angebaut wurden.
Susanne Wurst plädiert für ein neues »Bodenbewusstsein«: Nur wenn wir die Bedeutung des Bodens für Klima, Artenvielfalt und unsere Ernährung erkennen, werden wir ihn nachhaltig schützen. Zum Beispiel indem die bestehenden Gesetze konsequent angewendet werden.
Titelangaben
Susanne Wurst: Der Boden lebt
Kleinstlebewesen, unsere Erde und das Klima
Bern: Haupt Verlag 2025
167 Seiten, ca. 26 Euro/CHF
Reinschauen
| Leseprobe