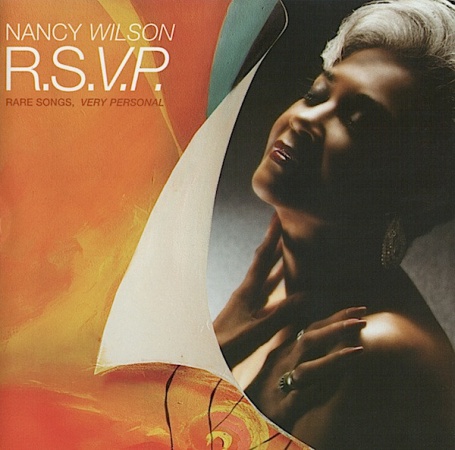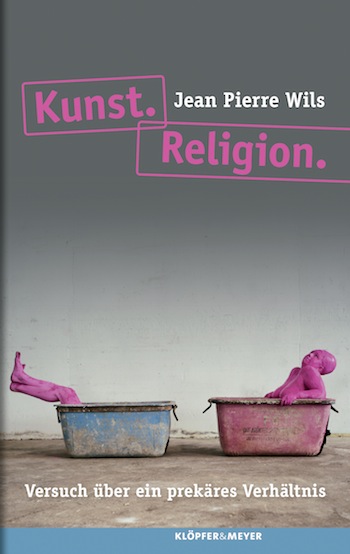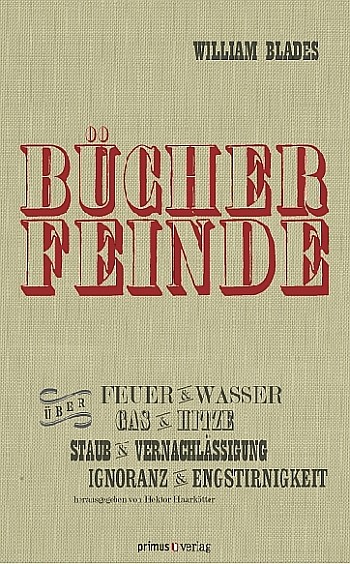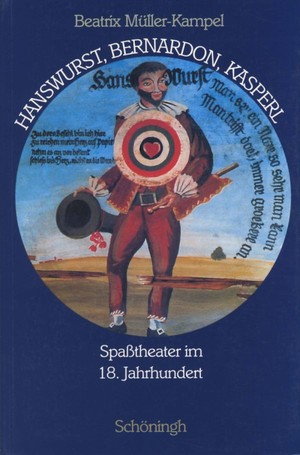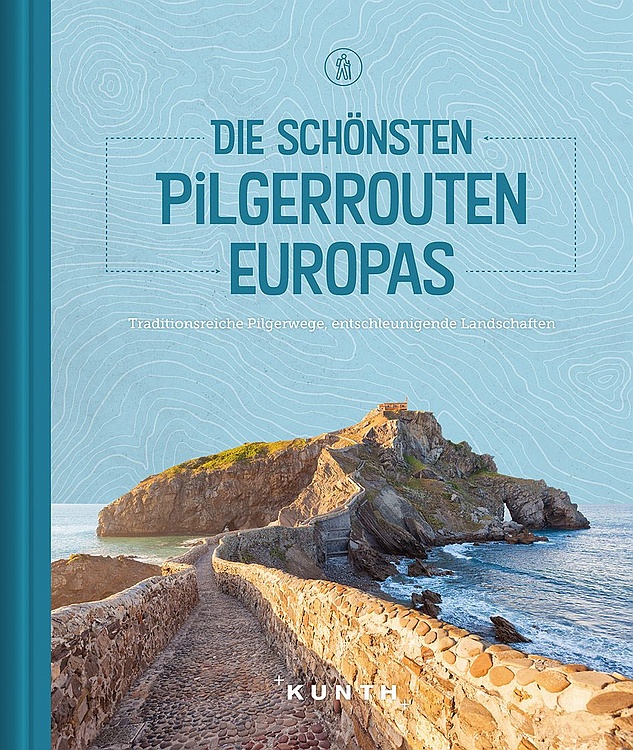Der Ingeborg-Bachmann-Preis ist singulär und paradigmatisch zugleich. An ihm werden viele Charakteristika des Literaturbetriebs und unserer Gesellschaft insgesamt erkennbar. Von THOMAS ROTHSCHILD
 Über den Ingeborg-Bachmann-Preis gibt es kein unbefangenes Sprechen. Wer sich dazu äußert, ist – so oder so – mit dem Objekt seiner Rede verbandelt. Die einen haben dort gelesen oder saßen in der Jury, die anderen hätten gerne gelesen oder wären gerne Mitglieder der Jury gewesen.
Über den Ingeborg-Bachmann-Preis gibt es kein unbefangenes Sprechen. Wer sich dazu äußert, ist – so oder so – mit dem Objekt seiner Rede verbandelt. Die einen haben dort gelesen oder saßen in der Jury, die anderen hätten gerne gelesen oder wären gerne Mitglieder der Jury gewesen.
Nicht zufällig zeichnen sich fast alle journalistischen Berichte aus Klagenfurt durch einen süffisant ironischen Ton aus. Das macht: Jeder Berichterstatter, in der Regel ein Literaturredakteur oder ein regelmäßiger Mitarbeiter des Feuilletons, muss beweisen, dass er (oder sie), wäre er selbst Juror gewesen, bessere Autoren eingeladen, ein richtigeres Urteil gefällt hätte als die zufällig bestallten. Es gibt nicht wenige, die zu den härtesten Kritikern der Veranstaltung gehörten, ehe sie zur Teilnahme am Wettbewerb, sei es als Autor, sei es als Juror, eingeladen wurden. Manche schafften es sogar, zunächst als Autor und dann als Juror dabei zu sein.
Auch Doris Moser, deren umfangreiche Dissertation über den Ingeborg-Bachmann-Preis jetzt als Buch erschienen ist, nähert sich ihrem Gegenstand nicht voraussetzungslos mit wissenschaftlicher Neutralität. Sie war über einige Jahre hinweg Sekretärin des Unternehmens, Angestellte also jener Institution, die sie nun zu untersuchen hatte.
Sie tut das Klügste, was man in solch einer Lage tun kann: Sie beschreibt und verzichtet weitgehend auf Wertungen. Aus ihrer Darstellung aber lässt sich eine Menge lernen. Denn der Ingeborg-Bachmann-Preis ist singulär und paradigmatisch zugleich. An ihm werden viele Charakteristika des Literaturbetriebs und unserer Gesellschaft insgesamt erkennbar.
Das Stichwort »Börse« im Untertitel verrät die dominierende Perspektive der Arbeit. So wird auch mit Blick auf die Autoren von »Einsatz, Gewinn und Verlust« gesprochen. Ein Hauch von 68 weht herüber, wenn eine Germanistin über eine literarische Veranstaltung nicht in erster Linie idealistisch verklärend, sondern – mit Berufung auf Bourdieu – in ökonomischen Kategorien schreibt. Damit ist das Phänomen Ingeborg-Bachmann-Preis zwar nicht völlig abgedeckt – und Moser beschränkt sich auch nicht darauf –, aber es ist doch ein entscheidender und meist ignorierter Aspekt angesprochen.
Der systematische Aufbau der Arbeit wird durch historische Untergliederung konterkariert. Die zwanzig Jahre von der Gründung des Wettbewerbs bis 1996, denen sich die Arbeit im Kern widmet, zeichnen sich eher durch Kontinuität als durch Brüche aus, aber es gibt im Detail Unterschiede, die Moser nicht unterschlägt. Die empirischen Befunde liefern soziografische Profile der am Event »Ingeborg-Bachmann-Preis« beteiligten Gruppen. Wie in ähnlichen Fällen lassen sich viele Ergebnisse ahnen, werden sie durch Statistiken lediglich präzisiert. Nicht alle Prozentzahlen sind aussagekräftig, und an der Aufrichtigkeit bei der Beantwortung von Fragebögen darf gezweifelt werden. Die Antworten schmeicheln den Befragten allzu auffällig.
Dennoch: Im Großen und Ganzen ergeben die Daten ein plausibles Bild eines gesellschaftlichen Sektors, der sich vor dem Hintergrund der Gesamtgesellschaft einigermaßen exotisch ausnimmt. Gerne erführe man, wie die Verkäuferin im Lebensmittelladen an der Ecke den Wettbewerb wahrgenommen hat. Oder der Kellner, der den Vogelbeerschnaps servierte, für den die Exsekretärin der Veranstaltung freundliche Worte findet.
Ein wichtiger Aspekt des Klagenfurter Wettbewerbs ist die mediale Repräsentation, die Liveausstrahlung durch 3sat und deren Auswirkung auf die Beteiligten. Doris Moser schenkt diesem Gesichtspunkt relativ viel Beachtung. Er ist auch von prinzipieller Bedeutung. Immerhin ist der Wettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis die einzige Gelegenheit für das Fernsehen, Autoren ausführlich mit ihren nicht szenischen Werken zu Wort kommen zu lassen, statt sie von mehr oder weniger kundigen Sekundärverwertern paraphrasieren zu lassen.
Besonders lesenswert ist das über 35 Seiten hinweg dokumentierte Fallbeispiel Allemann (Stichwort »Babyficker«). Gerade weil es als extrem erscheint, entstellt es mancherlei bis zur Kenntlichkeit, was dem Ingeborg-Bachmann-Preis wesentlich ist.
Doris Moser schreibt einen eleganten, für (österreichische) Dissertationen ungewöhnlichen Stil, scheut nicht vor Bonmots und aphoristischen Formulierungen zurück und könnte so mit ihrem Wälzer auch interessierte Leser jenseits des engen Kreises der Fachgermanisten erreichen.
Titelangaben
Doris Moser: Der Ingeborg-Bachmann-Preis
Börse, Show, Event
Wien – Köln – Weimar: Böhlau Verlag 2004
552 Seiten, 49 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander