Roman | Hans-Ulrich Treichel: Frühe Störung
London, Paris, New York beherbergen in ihren Konsumtempeln den modernen Jetset. Was jedoch verbindet den Darß, Kalkutta und Fiumicino miteinander? – fragt unser Rezensent HUBERT HOLZMANN. Es ist nicht nur Reiseliteratur wie der Held in Hans-Ulrich Treichels neuem Roman Frühe Störung befindet.
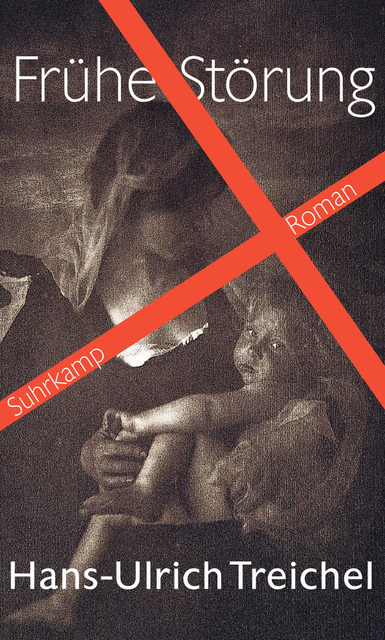 In Frühe Störung breitet der derzeitige Direktor des Leipziger Literaturinstituts Hans-Ulrich Treichel wieder einmal einen nicht unbedingt ganz schweren, aber wahrlich auch keinen leichten »Fall« von Bindungsangst aus. Und auch diesmal steht nach Der Verlorene (1998), Menschenflug (2005) und Anatolin (2008) wieder Familie im Vordergrund. Jedoch nicht seine eigene. Direkte autobiografische Bezüge fehlen. Treichels Held ist dennoch – wie kann es anders sein – ein verkappter Schriftsteller, der an Reiseführern schreibt, über Darß und Zingst, über Rom, Indien, Kalkutta.
In Frühe Störung breitet der derzeitige Direktor des Leipziger Literaturinstituts Hans-Ulrich Treichel wieder einmal einen nicht unbedingt ganz schweren, aber wahrlich auch keinen leichten »Fall« von Bindungsangst aus. Und auch diesmal steht nach Der Verlorene (1998), Menschenflug (2005) und Anatolin (2008) wieder Familie im Vordergrund. Jedoch nicht seine eigene. Direkte autobiografische Bezüge fehlen. Treichels Held ist dennoch – wie kann es anders sein – ein verkappter Schriftsteller, der an Reiseführern schreibt, über Darß und Zingst, über Rom, Indien, Kalkutta.
Hans-Ulrich Treichel dröselt in Frühe Störung wieder einmal ein Familiengefüge auf, setzt sich mit der Mutter-Sohn-Beziehung am Beispiel seines Helden Franz, der vom Familienerbe in Berlin eigentlich nahezu unabhängig leben kann, auseinander. »Unabhängig« ist dabei das zentrale Stichwort, das für Franz nur in Verbindung mit »abhängig« gedacht werden kann. Denn obgleich Franz, ein Mann der mitten im Leben steht, längst nicht mehr bei »Muttern« wohnt, ist sie in seinem Leben die entscheidende Instanz.
»Mutter Mutter Mutter«
Frühe Störung setzt dabei an dem Punkt an, an dem Franz sein »Problem« durchaus recht erfolgreich therapiert hat. Er lebt und handelt sehr bewusst, weiß viel über sich und sein Unterbewusstsein. So erzählt Treichel eigentlich ein Stück von Franz’ Familiengeschichte: über den Konkurs des Vaters, die unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten glücklichere zweite Ehe der Mutter, Franz’ Kindheit, die Arbeit als Journalist während der Wendezeit. von der eigenen Wohnung, den Reisen. Vor allem bestimmt Franz allerdings eines: das »unablässige Mutter Mutter Mutter in meinem Gehirn«.
Diese eine »Übermutter« ist der archimedische Punkt in seinem Leben. Alle Ausbruchsversuche machen dieses ungelöste Problem nur umso deutlicher. Daraus entwickelt sich eine tief tragische und zugleich extrem komische Geschichte. Und Franz steckt in einem tiefen, nicht zuletzt moralischen Dilemma: Franz kümmert sich zu wenig um seine allein lebende Mutter. Das »Kernproblem«: »Die Ferne, nach der ich mich sehnte, war vor allem die Mutterferne. Und die Ferne, vor der ich mich fürchtete, war dieselbe Mutterferne.«
Das ist nicht nur auf Fernreisen der Fall, sondern schon dann, wenn er ganz harmlos durch Berlin geht. Er hört eine Stimme. »Die Stimme sagte jedoch nicht Mutter Mutter Mutter, sondern ’Franz!’. Mit Ausrufezeichen.« Die Komik in dieser Situation wird dadurch unterstrichen, weil bei Franz nun die Gedanken zu schweifen beginnen: sieht sich »fimreif« in einer Woody Allen-Szene, erinnert sich an die Kindheit, an die Wohnung im Hochparterre, an die »Ruf- beziehungsweise Schreistimme meiner Mutter«, an sein Kindheitsparadies.
Paradies und Kultur-Speicher
Treichels Held Franz stimmt jedoch nicht ein in den Trauergesang über das verlorengegangene Paradies. Er weiß seine behütete Kindheit, seine bourgeoise Lebensweise, seine klassische Bildung zu schätzen: zitiert Episoden der griechischen Klassiker, besitzt kunstgeschichtliche Fundamente, jongliert mit historischen Anekdoten, erweist sich als geografisch geschulter Reisebegleiter und beherrscht selbstbewusst Namedropping im zufälligen Nebenbei.
Ebenso hat er jedoch mit all diesen Wissensdetails zugleich auch Erinnerungen abgespeichert, die ihn und seine Mutter betreffen. Zutiefst kurios etwa die Reise nach Ahrenshoop zusammen mit seiner Mutter, um eine Neuauflage seines Reiseführers über Darß und Zingst vorzubereiten. In seinem Kopf erinnert ihn als Ohrwurm die Musik von »Then there was music and wonderful roses« – jedoch wiederum mit tiefer ironischer Tragweite. Und Treichel führt das Motiv der Musik weiter aus: als Schlaflied, das die Mutter nie »vorgesungen«, als Geigen- und Rosenmotiv für der Mutter Glanz zum »einzigen Schlaflied, das ich kannte«, und als »Schnarchgeräusche der Mutter während des Mittagsschlafes, die mir in den Ohren dröhnten, wenn ich neben ihr lag«.
Die Beschreibung der Mutter, ihre Eigenschaften, ihre Charakterzüge werden ebenfalls mit Bildern aus der Welt des Wissens geschildert. Franz nutzt sein ornithologisches und zoologisches Wissen, wenn er daran denkt, wie er als Kind diese Mittagsstunden auf dem Sofa überstehen musste: Franz erblickt Mutters »Eidechsenaugen«, eine »Eidechsenzunge«, er befürchtet, den »Schnappmechanismus auszulösen«. Wünscht sich selbst: »Nicht tot sein und nicht lebendig. Allenfalls ein Kieselstein wäre ich gerne gewesen… Trocken, rund und vollkommen gefühllos.« Und immer schwingt etwas höchst Trauriges im Unterton mit. Denn die Mutter ist krank. Eine Brust muss amputiert werden. Metastasen werden festgestellt.
Trümmer und Fragmente der Erinnerung
Die traumatischen Kindheitserfahrungen führen nun geradewegs auf die Couch des Psychoanalytikers. Treichel kommt bereits in den Eingangsseiten seines Romans auf Hochtouren: seine Kunst das Erzählmotiv der Mutterbindung zu verdichten, kurze Exkursionen zu Anekdotischem über Sigmund Freud zu unternehmen, über das verstaubte Inventar der Analysepraxis zu spötteln, biografische Notizen über die Familie einzustreuen – in dieser furiosen Exposition blättert Treichel den Roman auf.
Franz Arbeit an der Neuauflage seines Reiseführers ist Programm. Wird zu Treichels Erzählprinzip einer ständigen Revision, Aktualisierung. Der Roman eine Fortschreibung der Therapiesitzungen. Analyse der Gedanken, des Erlebten. Dabei ohne wirklich festgeschriebenes Erzählschema. Es darf völlig frei assoziiert werden. Das Kernprinzip dabei: die Wiederholung, das Wiederaufgreifen von Motiven, das Zweimalsagen. Treichel formuliert einen Gedanken, wiederholt, variiert ihn, er spinnt ihn fort und verortet ihn zugleich.
Die Romreise führt Franz beispielsweise zur Pietà in den Vatikan. Die Situation erinnert ihn an seine Mutter, die »auf dem Operationstisch lag, der die Brust amputiert wurde und die ein Trostlied für mich sang«. Diese Pietà hat es Franz angetan und er kommt noch des Öfteren auf sie zu sprechen. Dieses kalte, steinerne Kunstwerk löst aber ebenfalls untergründige Begier aus: »Ich hätte dieser steinernen Madonna dort im Petersdom am liebsten meine Hand auf den Mund, auf die kühlen marmornen Lippen gelegt, um ihr den Mund zu verschließen.« Und Franz wird noch deutlicher. Aber nicht ganz so direkt.
Er erinnert sich an den Ungarn Laszlo Toth, der »mit einem Hammer auf sie eingeschlagen hatte.« Und führt dann ganz exakt die näheren Umstände aus: »Mit einem Geologenhammer, denn Toth war von Beruf Geologe, was ja ein interessanter Beruf ist und auch mit Geographie zu tun hat. Mich jedenfalls hat die Geologie immer interessiert. Steine überhaupt.« Franz würde am liebsten wohl auch zum Hammer greifen. Überlässt dies stellvertretend aber den anderen.
So wird Treichels Roman Frühe Störung zu einem analytischen Hin und Her, einem Abwägen, einem Diskurs über Ich und den großen Anderen. Franz ist ganz und gar durch die Mutter geformt, durch ihre Welt bestimmt und konfiguriert. Hans-Ulrich Treichels Frühe Störung ist nicht nur für alle »Muttersöhne« als Pflichtlektüre empfohlen.
| HUBERT HOLZMANN
Titelangaben:
Hans-Ulrich Treichel: Frühe Störung
Berlin: Suhrkamp 2014
189 Seiten. 18,95 Euro
Reinschauen
Leseprobe



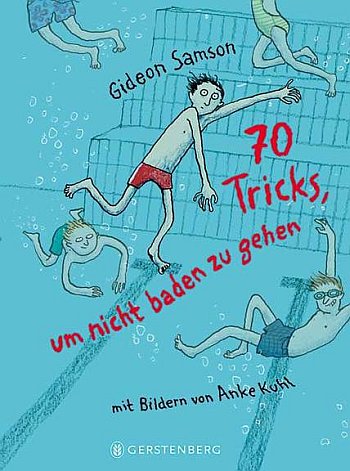




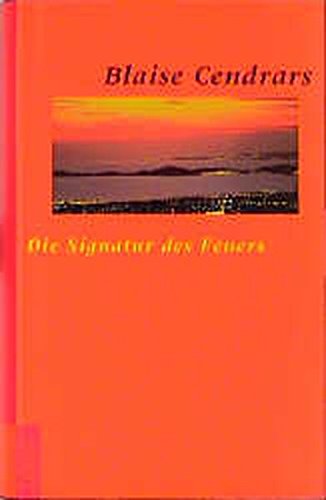
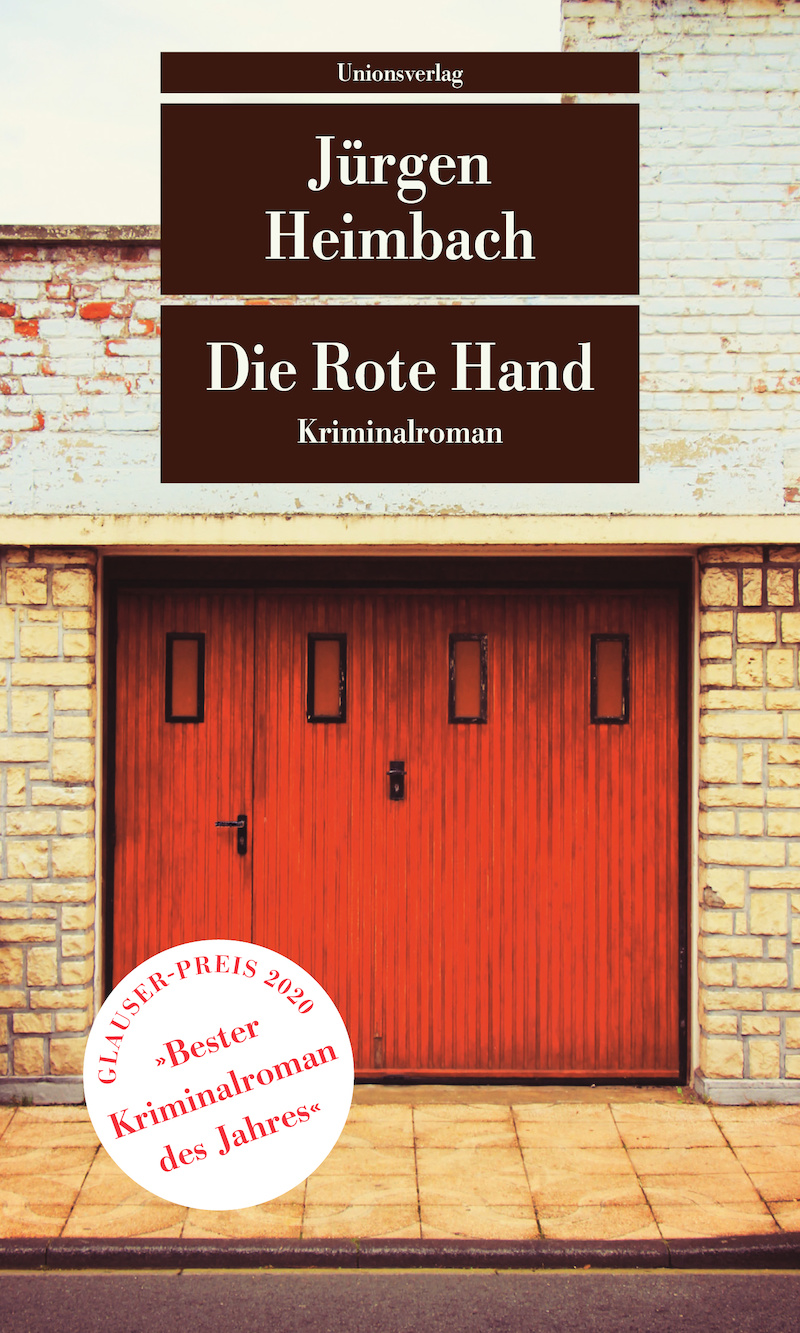

[…] Reinschauen | Leseprobe | Mehr zu Hans-Ulrich Treichel in TITEL kulturmagazin […]