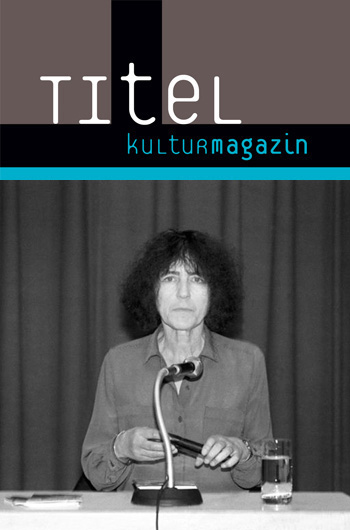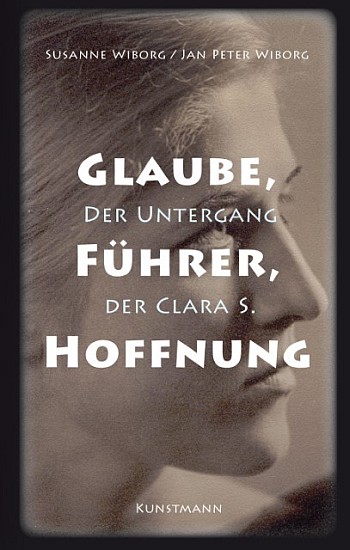Bühne | Hermann Hesse: ›Das Glasperlenspiel‹ im Badischen Staatstheater Karlsruhe
Wahre Gesellschaftskritik im ewigen Konflikt des Individuums mit der Gesellschaft, im Spiel der Moderne mit ihren Ängsten, hin- und hergerissen zwischen Mikro- und Makrokosmos in Anlehnung an Johann Wolfgang Goethes ›Faust‹ – das ist Hermann Hesses ›Das Glasperlenspiel‹ im Kleinen Haus des Badischen Staatstheaters Karlsruhe. Für die Bühne bearbeitet von Martin Nimz und Konstantin Küspert wird es damit zum modern interpretierten und dramaturgisch inszenierten Aufstieg und Fall des Protagonisten Josef Knecht. Von JENNIFER WARZECHA

Es gibt manche Konflikte, die nur auf den ersten Blick hin wie auf eine Zeit begrenzt erscheinen. Ein solcher ist zum Beispiel der des einzelnen Menschen, mit seiner Umwelt konform zu werden, sich anzupassen oder es schlichtweg sein zu lassen und seinen eigenen Weg zu finden. Josef Knecht (Jung und sehr überzeugend in seiner Darstellung: Jonathan Bruckmeier, alt und sehr gemäßigt bezüglich des Auftretens: André Wagner) ist solch ein Beispiel. Als über die Maßen interessierter und aufgeschlossener sowie begabter junger Mann schafft er durch den Musikmeister und hohen Funktionär der Bildungsprovinz Kastalien (imposant und überzeugend: Hannes Fischer) den Eintritt in eine der Eliteschulen Kastaliens. Hier soll er den hohen Anforderungen genügen, die unter anderem darin bestehen, auf die Ehe zu verzichten und Disziplin zu wahren.
Die entsprechenden Hintergrundinforationen und Zusammenhänge werden dem Zuschauer als Rückblenden in einer im Stil eines Interviews angelegten Rahmenhandlung präsentiert, in der der alte Kastilische Meister Alexander (Witzig und einfallsreich: Berthold Toetzke) seinem Gegenüber (Spitzbübisch, kokett und einfach überzeugend: Veronika Bachfischer), das als Punk im Look der 90er Jahre wiederum den aktuellen Zeitbezug herstellt, das Leben in Kastilien im Allgemeinen und das des Josef Knecht im Besonderen erörtert.
Leben im ständigen Widerstreit der Gefühle
Die strengen Regeln und hohen Anforderungen Kastiliens bringen den Protagonisten unter anderem in ständigen Widerstreit zu seinem Gegenüber Plinio Designori (Jung und sehr impulsiv, aber dennoch überzeugend: Maximilian Grünewald, etwas gemäßigter, aber dennoch robust, der ältere: Frank Wiegard), einem externen Schüler, der beinahe wie ein Alter Ego, wie ein alternativer Lebensentwurf zu dem des Protagonisten wirkt. Er darf die Schule allein aufgrund des politischen Einflusses seines Elternhauses besuchen, ohne Mitglied der Provinz zu sein.
Sein Widerwille gegen das System drückt sich aber gerade darin aus, dass er nicht nur im dandyhaften Outfit im Stile James Deans angriffslustige Dialoge mit Josef Knecht führt. Wie vom Irrsinn getrieben, rennt er auf einmal nackt auf der Bühne herum, einem weißen, unmittelbar im Zuschauerraum platzierten Septagon (Siebeneck), das mitten über den Zuschauerraum und die Bühne hineingesetzt wurde. Das von dem Bühnenbildner Sebastian Hannak erschaffene Bühnenbild besteht außerdem aus einem Innenraum, der aus innenliegenden sieben großen, aufeinander zulaufenden Schrägen besteht. Diese sind in unterschiedlichen Neigungen ineinander verkeilt und lassen in der Mitte ein großes Loch frei stehen. Wie auch hier das Programmheft schildert, mag dabei der Eindruck eines Trichters entstehen, eines abgelassenen Sees, eines Grabes, von verkanteten Eisschollen.
Der Widerwille gegen das gängige System dominiert das Geschehen

Im Zusammenhang mit der Gegenwart und in Bezug auf Hesses Kritik des feuilletonistischen Zeitalters als Zeichen der »Selbstaufgabe, Käuflichkeit und Entwürdigung des Geistes« (siehe Programmheft) ist festzustellen: Gerade im Zeichen von großer Medialität, wie die Einspielungen aktueller und moderner zeitkritischer Themen, zum Beispiel den Einspielungen im Stile Leni Riefenstahls, die Hitlers Reichsparteitage und Olympische Spiele martialisch-bildgewaltig und nach Werten des Regimes filmisch verewigte, mitsamt ihrer ästhetischen Nacktbilder, Protesten gegenüber dem Gebaren Barack Obamas oder immer wieder symbolhafter, von Autonomie und Freiheit geprägten Zeichen, Bilder, Fotos und Symbole beweisen: Kultur und Werte zu bewahren, ist heute im Zeichen der recht positiv erscheinenden freien Zuordnung der Werte und Freiheiten recht beliebig. Den Spagat zwischen sich und den gesellschaftlichen Werten zu finden, ist immer Thema.
Die Aktualität des Stückes beweist: Kulturelle Werte zu bewahren, ist immer noch in
Das beweist schon Hesses Biografie, der sich von seiner pietistischen Umgebung und der Ignoranz des individuellen Werdegangs nicht stören ließ, auch wenn er sich selbst Therapien unterzog. Kulturelle Werte zu bewahren ist damit das Glasperlenspiel und Roulette der Zeit und damit ein Erfolg. Das beweist der tosende Beifall über die Aufführung des 600 Seiten – und hier auf 18.000 Wörter komprimierten – umfassenden Romans nach Hesses gesammelten Lebenszitaten Robert Knechts, der mitunter von der Logik der Handlung schwer nachvollziehbar, aber doch präsentisch ist, im prall gefüllten Kleinen Haus am Ende des Stückes. Der »Versuch einer Lebensbeschreibung« des Josef Knecht und des damit neuzeitlich erscheinenden Bildungsromans im Zuge von Autoren wie Robert Walser oder Siegfried Kracauers ›Die Angestellten‹, eine »forensisch rekonstruierte Lebensgeschichte«, wie es wiederum das Programmheft schildert, ist damit eindeutig gelungen.
Titelangaben
Das Glasperlenspiel
nach dem Roman von Hermann Hesse
Für die Bühne bearbeitet von Martin Nimz & Konstantin Küspert
Badisches Staatstheater Karlsruhe