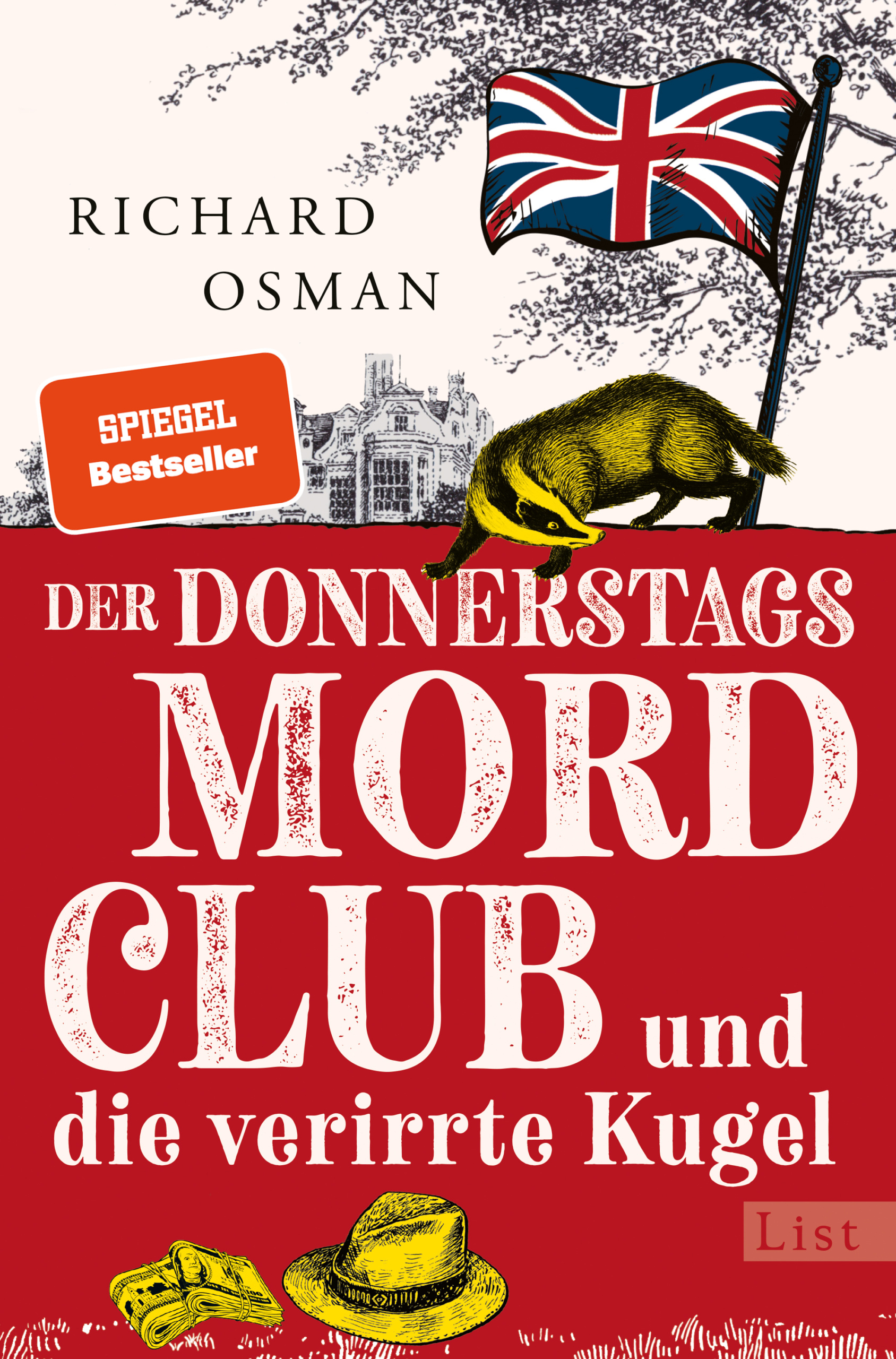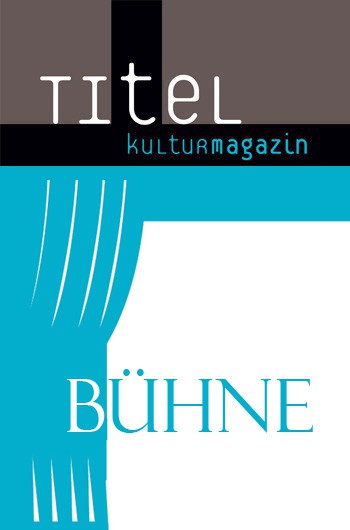Vielen wohlbekannt ist die Lektüre des ›Woyzeck‹, nicht ›Wozzeck‹, von Georg Büchner schon aus der Schulzeit. Dementsprechend waren auch viele Schülerinnen und Schüler sowie junge Menschen an diesem Samstagabend zu Gast im Badischen Staatstheater bei der Oper in drei Akten von Alban Berg mit dem Titel ›Wozzeck‹. Jedem und jeder von ihnen war nach diesem Abend anzusehen, dass ihm und ihr diese Aufführung sichtlich nahe ging – und hinsichtlich aller Facetten der Theaterkunst auf ganzer Linie überzeugte. Von JENNIFER WARZECHA
Die Bühnenbilder eröffnen durch ihre neuen futuristischen Formen ebenso neue Blickwinkel aufs Stück und was dessen im Innersten zusammenhält. Zuschauerinnen und Zuschauer werden in eine Welt des Proletariats entführt und ebenso in eine solche, in der man gewahr wird, wo die Grenzen menschlicher Sehnsüchte und Bedürfnisse oder auch Fragen nach Tod und dem Teufel liegen.
 Die Frage ist: Sind wir nicht wirklich alle so wie Wozzeck? Wir sind natürlich und gewiss nicht alle Mörder, zu dem der Protagonist (ausdrucksstark, authentisch und empathisch: Birger Radde a. G.) aus Eifersucht wird. Was uns dieses sozialkritische und von Georg Büchner weiterentwickelte Drama aber immer wieder und gerade in dieser Inszenierung in der Regie von Maxim Didenko vermitteln möchte, ist, zu zeigen, an welchen Grenzen sich der Mensch oft bewegt – denen zwischen verletzter Eitelkeit, Wut und Wahnsinn, verletztem Ehrgefühl, Trauer und Verzweiflung. Wozzeck wird vor dem Doktor (ebenfalls beeindruckend: Vazgen Gazaryan) schon zu Beginn zum Versuchskaninchen. Für seine Familie, Frau und Kind, verdient er sein Geld. Dabei ist er sich für nichts zu schade. Marie (überzeugend-authentisch und feminin: Helena Juntunen a. G.) kann das sicherlich nicht so annehmen, wie Wozzeck das sicherlich verdient hätte. Sie kümmert sich rührend um ihren gemeinsamen Sohn (authentisch: Levin Priemer; Cantus Juvenum e.V.). Dabei wird sie Opfer ihrer eigenen Sehnsüchte und Leidenschaften. Angedeutet wird das schon im ersten Moment, an dem sie auf der Bühne zu sehen ist, als sie mit übergroßen langen Beinen in erotisch-rotem Kleid auftaucht. Immer wieder tanzen Tänzerinnen und Tänzer in rotem Kleid und manches Mal auch mit rotem Ballon auf der Bühne entlang. Das Rot verdeutlicht die Liebe, und wie sie einen verführen kann, aber auch das Rot des Blutes. Auch der Tambourmajor (beeindruckend-selbstbewusst: Thomas Paul a.G.) erscheint stellenweise in total rotem Kostüm. Er macht sich an seine Geliebte ran mit selbstbewusstem Griff an die Taille. Oberhalb der beiden wird eine weitere Marie eingeblendet mit unschuldig-blonden Haaren, aber mit einem Kleid in ebenso leidenschaftlichem Rot. Sie umschmeicheln, nein, umklammern Brust und Taille und nehmen sie für sich ein.
Die Frage ist: Sind wir nicht wirklich alle so wie Wozzeck? Wir sind natürlich und gewiss nicht alle Mörder, zu dem der Protagonist (ausdrucksstark, authentisch und empathisch: Birger Radde a. G.) aus Eifersucht wird. Was uns dieses sozialkritische und von Georg Büchner weiterentwickelte Drama aber immer wieder und gerade in dieser Inszenierung in der Regie von Maxim Didenko vermitteln möchte, ist, zu zeigen, an welchen Grenzen sich der Mensch oft bewegt – denen zwischen verletzter Eitelkeit, Wut und Wahnsinn, verletztem Ehrgefühl, Trauer und Verzweiflung. Wozzeck wird vor dem Doktor (ebenfalls beeindruckend: Vazgen Gazaryan) schon zu Beginn zum Versuchskaninchen. Für seine Familie, Frau und Kind, verdient er sein Geld. Dabei ist er sich für nichts zu schade. Marie (überzeugend-authentisch und feminin: Helena Juntunen a. G.) kann das sicherlich nicht so annehmen, wie Wozzeck das sicherlich verdient hätte. Sie kümmert sich rührend um ihren gemeinsamen Sohn (authentisch: Levin Priemer; Cantus Juvenum e.V.). Dabei wird sie Opfer ihrer eigenen Sehnsüchte und Leidenschaften. Angedeutet wird das schon im ersten Moment, an dem sie auf der Bühne zu sehen ist, als sie mit übergroßen langen Beinen in erotisch-rotem Kleid auftaucht. Immer wieder tanzen Tänzerinnen und Tänzer in rotem Kleid und manches Mal auch mit rotem Ballon auf der Bühne entlang. Das Rot verdeutlicht die Liebe, und wie sie einen verführen kann, aber auch das Rot des Blutes. Auch der Tambourmajor (beeindruckend-selbstbewusst: Thomas Paul a.G.) erscheint stellenweise in total rotem Kostüm. Er macht sich an seine Geliebte ran mit selbstbewusstem Griff an die Taille. Oberhalb der beiden wird eine weitere Marie eingeblendet mit unschuldig-blonden Haaren, aber mit einem Kleid in ebenso leidenschaftlichem Rot. Sie umschmeicheln, nein, umklammern Brust und Taille und nehmen sie für sich ein.

Auch Marie wird zur Gefangenen ihrer Leidenschaften, an dessen Ende ihr Tod durch Mord steht. Aber ist es nicht genau das, was Georg Büchner im Zitat »Der Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hinunterschaut« auch ausdrücken möchte? Alban Berg bringt das wohl berühmteste, knappste, ungewöhnlichste und erschütterndste musikalische Symbol der Tragödie zwischen dem 12. und 13. Bild, der Mord- und Wirtshausszene. Wie das Programmheft näher erläutert, geht diese sogenannte Invention über den Ton H wie »Heiland, erbarm Dich meiner.« Sie sind Maries letzte Worte im 11. Bild, das als Verweis auf die sieben letzten Worte des Erlösers am Kreuz auf der Zahl 7 aufgebaut ist – sieben Variationen über ein 7-taktiges Thema und Doppelfuge über ein Thema aus sieben Tönen – und auf den Ton H zuläuft. H ist der Leitton für ein C-Dur. Dieses tritt in der Tragödie natürlich nie ein. Nun könnte man die Analyse weiter betreiben, wie es schon häufig in der Literaturwissenschaft erfolgt ist, ist doch eine weitere Besonderheit dieses Dramas, dass es als Dramenfragment vorliegt, bei dem nie eindeutig vom Autor die Reihenfolge festgelegt worden ist.
Entscheidend ist aber, wie in einem solchen Stück allein sämtliche Sehnsüchte offenbar werden, die Menschen eben auch zum Mord verleiten können. Was ist Sünde, was ist einfach nur menschlich?, fragt man sich. Auch wie die Wissenschaft im Laufe der Zeit die Kirche, nicht die Religion, mehr aus dem Leben der Menschen verdrängt, erfährt der Zuschauer, gerade am Beispiel des Doktors. Trotz der Tragödie gibt es aber immer wieder auch fröhliche Szenen der Menschen drum herum.
Symbolisieren sie die Spaß-Gesellschaft, der alle Konventionen und Werte egal zu sein scheinen? Oder einfach nur die pure Lebensfreude, die man trotz aller Dramen und Krisen der Welt doch noch haben darf, um gesund zu bleiben? Jede und jeder möge sich diese Fragen selbst beantworten. »Wozzeck« in Karlsruhe anzusehen, bedeutet keine Freude an für sich – das wäre vermessen, das angesichts einer Tragödie zu behaupten, aber es weckt das Bedürfnis in einem selbst, viele wichtige Dinge des Lebens zu hinterfragen – und ist äußerst gelungen! Auch Dirigent Justin Brown, der als Gast ans Pult der Staatskapelle zurückkehrte, begeisterte musikalisch – zusammen mit allen Mitgliedern des Badischen Staatsopernchores, der Badischen Staatskapelle und des Cantus Juvenum.
Titelangaben
Wozzeck
Oper in drei Akten von Alban Berg
Nach dem Dramenfragment von Georg Büchner
Regie: Maxim Didenko
Bühne & Kostüme: Maria Tregubova
Video: Ilya Starilov
Licht: Christoph Pöschko
Choreografie: Alexander Fend, Sofia Pintzou
Chorleitung: Ulrich Wagner
Dramaturgie: Boris Kehrmann, Florian Köfler
Besetzung:
Wozzeck: Birger Radde a. G.; Jaco Venter a. G.
Tambourmajor: Thomas Paul a. G.
Andres: Eleazar Rodriguez; Nutthaporn Thammathi
Hauptmann: Kammersänger Matthias Wohlbrecht; Kammersänger Klaus Schneider
Doktor: Vazgen Gazaryan
Weitere Termine:
31.5., 20 – 21.45 Uhr; 9.6., 20 – 21.45 Uhr
29.6., 20 – 21.45 Uhr; 19.7., 20 – 21.45 Uhr