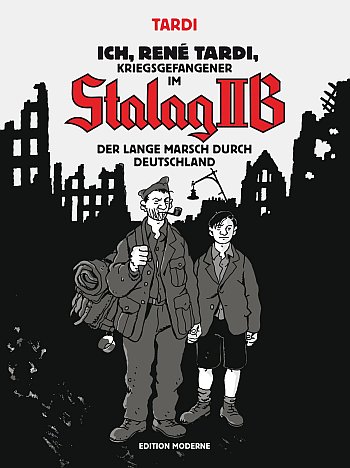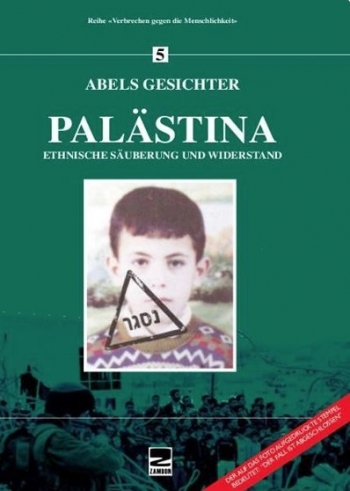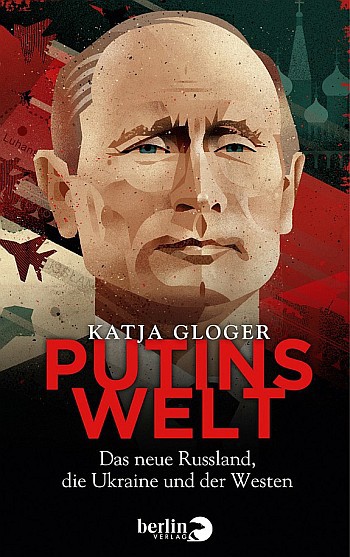Gesellschaft | Colin Crouch, Die bezifferte Welt. Wie die Logik der Finanzmärkte das Wissen bedroht
In seinem neuesten Werk zeichnet Colin Crouch, der den Begriff ›Postdemokratie‹ prägte, ein erschütterndes Bild von der britischen Gesellschaft der Gegenwart. Der Satz »There is no such thing as society«, fälschlich Margaret Thatcher zugeschrieben, trifft dennoch diesen Zustand und erklärt gleichzeitig, weshalb Jeremy Corbyn, von der elitären FAZ herablassend zum »Heilsbringer der Toten« degradiert, zum Favoriten für den Parteivorsitz der Labour Party wurde. Von WOLF SENFF
 Wobei die deutsche Fassung des Untertitels den Leser vor Rätsel stellt. Denn tatsächlich beschreibt Crouch anhand einer überwältigenden Fülle von Beispielen den »Financial Takeover of Public Life«, also die Machtergreifung des Finanzsektors über das öffentliche Leben. Da wirkt die Übertragung recht luschig.
Wobei die deutsche Fassung des Untertitels den Leser vor Rätsel stellt. Denn tatsächlich beschreibt Crouch anhand einer überwältigenden Fülle von Beispielen den »Financial Takeover of Public Life«, also die Machtergreifung des Finanzsektors über das öffentliche Leben. Da wirkt die Übertragung recht luschig.
Vertrauen in den ›Markt‹?
Crouch setzt sich mit dem Neoliberalismus und dessen radikaler ›Markt‹-Gläubigkeit auseinander, er unterscheidet »deutsche Ordoliberale«, die eine Regulierung des Marktes für notwendig halten, und »neoliberale Puristen«, denen zufolge sich der Markt selbst überwache; auch »moralische Verbote« seien deshalb »Hindernisse, die der Erreichung höchster Effizienz im Wege stehen«; letztere Variante dominiere in den angloamerikanischen Nationen.
Das Vertrauen in ein reibungsloses Funktionieren des Marktes sei jedoch in der Weltwirtschaftskrise 2007/08 generell schwer erschüttert worden. Crouch begründet überzeugend, dass ›der Markt‹ durch subjektive Interessen beeinflussbar sei, absichtlich gestreuten Fehlinformationen ausgeliefert und eben nicht, wie einst von seinem Theoretiker Friedrich von Hayek postuliert, »frei von systematischen Unzulänglichkeiten«, die Reformpolitik des Neoliberalismus sei demzufolge grundsätzlich in Frage zu stellen.
Einseitige Interessenlage
Crouch erinnert an die Katastrophen neuer Dimension, Deepwater Horizon vor New Orleans und Fukushima in Japan, beides Fälle, in denen es nachgewiesenermaßen ein »betrügerisches geheimes Einverständnis zwischen dem Unternehmen und den Aufsichtsbehörden« gab und Sicherheitsbedenken ignoriert wurden; im angloamerikanischen Raum dominiere jedoch bei Unternehmensentscheidungen stets das Interesse der Aktionäre, das auf Profitmaximierung hinauslaufe. Andere Interessen eines Unternehmens – Sicherheit, Gesundheit, Arbeitnehmer – seien absolut nachrangig.
Ähnlich einseitig habe sich der Umgang der EU mit Griechenland gestaltet, der für Entscheidungen lediglich Information aus der Finanzwelt zugelassen und andere Bereiche wie Infrastruktur, Gesundheit, Sozialstruktur, Arbeitslosigkeit gar nicht erst einbezogen habe.
Ab absurdum geführt
Dass so etwas wie ›der Markt‹ als ein System existiere, das gegensätzliche Interessen ausgleiche, ausbalanciere, erweist sich nach den vielfältigen Beispielen, die Colin Crouch heranzieht, als illusionär. Er erinnert an den Libor-Skandal, der Banken von Weltruf eine systematisch organisierte betrügerische Informationspolitik nachwies, an gezielt betriebenen, rufschädigenden Sensationsjournalismus und kalkulierte Tatsachenverdrehung in den »wichtigsten Organen der britischen und weltweiten Presse«.
Die Unterdrückung von negativen wissenschaftlichen Ergebnissen, eigene Produkte betreffend, betreibe vor allem die pharmazeutische Industrie. Crouch führt überzeugende Beispiele an, und auch der Versuch, im Lebensmittelbereich per Patentierung etwa bei gentechnisch verändertem Saatgut eine marktbestimmende Position zu ergattern, führt das Prinzip Marktwirtschaft nur noch ad absurdum, nicht zuletzt auch der skurrile Versuch der US-Firma RiceTec, sich den Begriff ›Basmati-Reis‹ patentieren zu lassen.
Öffentlicher Dienst
Die als ›New Public Management‹ angepriesene marktaffine Umgestaltung – auch »Privatisierung« bzw. »Deregulierung« – des öffentlichen Dienstes führte in Großbritannien zu weitreichenden Veränderungen, immer unter der neoliberalen Prämisse, dass finanzieller Anreiz die zentrale Motivation zur Arbeit liefere, das Arbeitsethos des Lehrpersonals sei demgegenüber absolut nachrangig.
Crouchs Beispiele aus dem englischen Schulwesen, das mittels Privatisierungen, Ranking und Testverfahren den Marktbedingungen angepasst wurde, sind haarsträubend, ebenso die Beispiele aus den Universitäten, die mittels Zielvorgaben und Kennziffern zwecks Evaluierung akademischer Forschung marktgerecht ›reformiert‹ wurden.
| WOLF SENFF
Titelangaben
Colin Crouch: Die bezifferte Welt. Wie die Logik der Finanzmärkte das Wissen bedroht
(The Knowledge Corruptors. Hidden Consequences of the Financial Takeover of Public Life. Cambridge 2015. Übersetzt von Frank Jakubzik)
Berlin: Suhrkamp 2015
250 Seiten, 21,95 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe