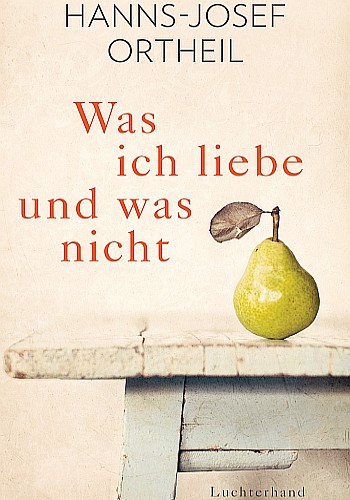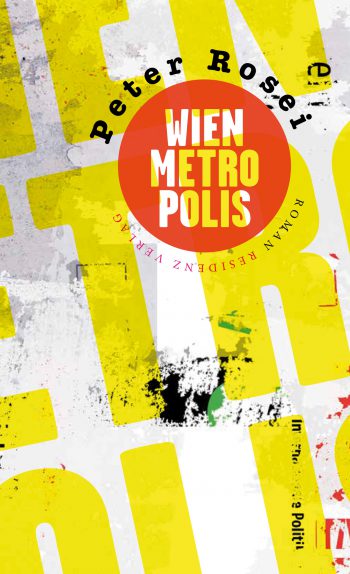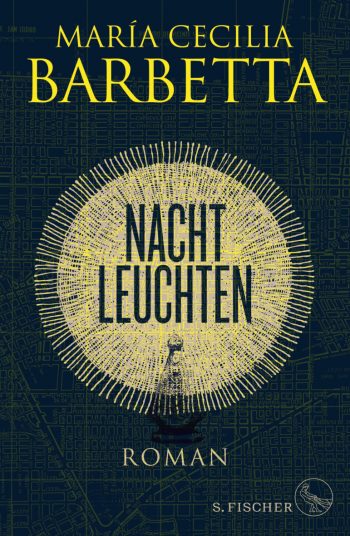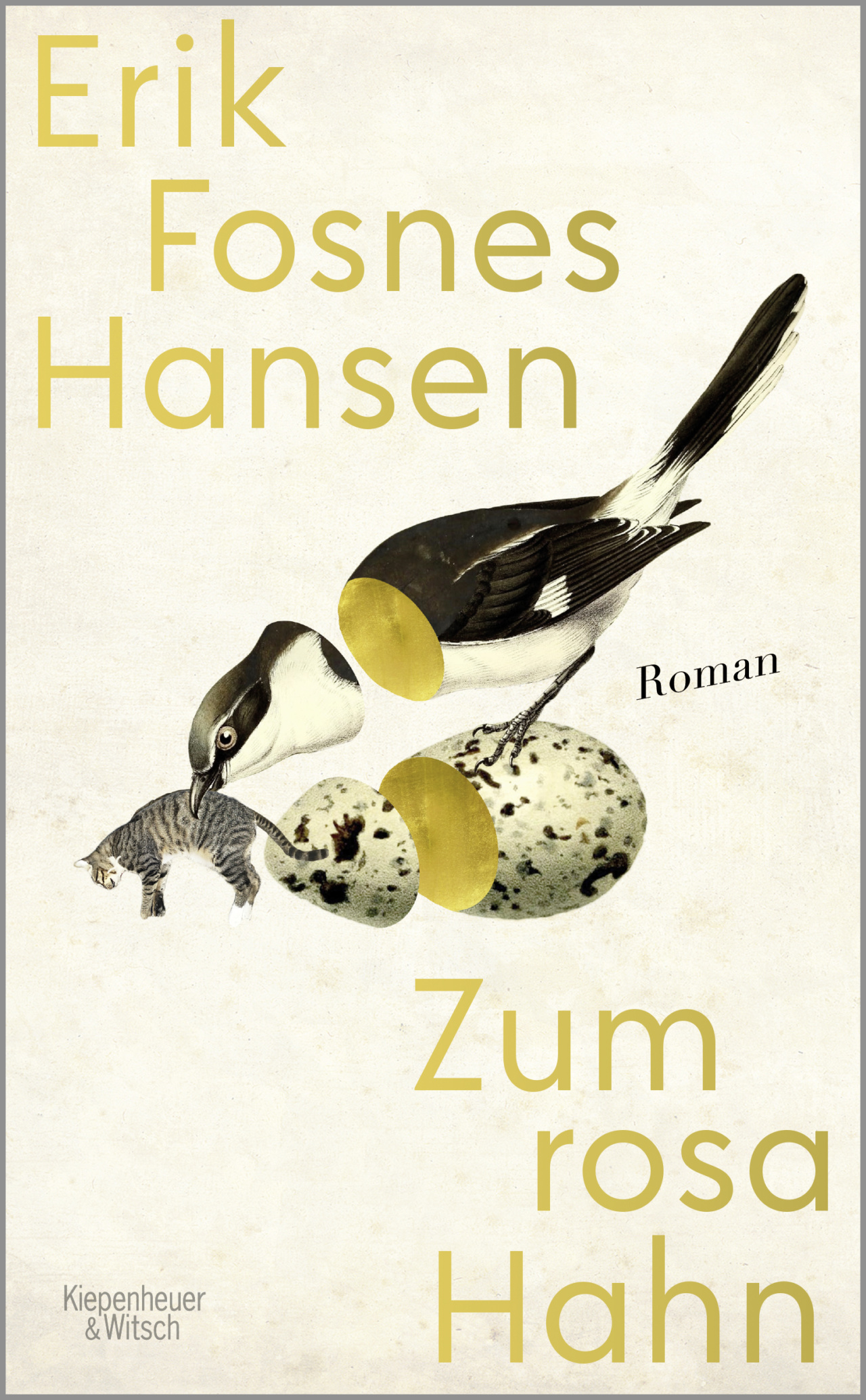Roman | Alois Brandstetter: Aluigis Abbild
Inmitten der Wirren des Dreißigjährigen Krieges bittet eine Witwe einen berühmten Maler um ein Porträt ihres seliggesprochenen Sohnes. Alois Brandstetters Briefverkehr zwischen Rubens und der Donna Marta Tana di Santena liest sich wie ein leicht ironisierendes Sittengemälde aus dem Barock, ein Wirrwarr aus Carpe Diem und Memento Mori. Doch so wie Aluigis Abbild nicht fertiggestellt wird, verliert sich auch der amüsierte Plauderton in barocken Nichtigkeiten. VIOLA STOCKER wird Zeugin einer Zerstreuung.
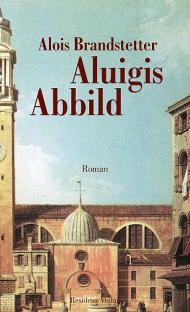 Donna Marta Tana di Santena, die verwitwete und bigotte Gattin eines spielsüchtigen und verarmten Gonzaga Fürsten aus Castiglione, findet in ihren einsamen Tagen auf ihrem Schloss den einzigen Trost im Gedanken, dass die Gemeinde Castiglione zu Ehren ihres seliggesprochenen Sohnes Aluigi ein Gotteshaus zu errichten plant. Die Fürstin hat beschlossen, dass niemand anders als der weltberühmte Peter Paul Rubens würdig sei, ein Altarbild mit dem Konterfei ihres Sohnes zu gestalten.
Donna Marta Tana di Santena, die verwitwete und bigotte Gattin eines spielsüchtigen und verarmten Gonzaga Fürsten aus Castiglione, findet in ihren einsamen Tagen auf ihrem Schloss den einzigen Trost im Gedanken, dass die Gemeinde Castiglione zu Ehren ihres seliggesprochenen Sohnes Aluigi ein Gotteshaus zu errichten plant. Die Fürstin hat beschlossen, dass niemand anders als der weltberühmte Peter Paul Rubens würdig sei, ein Altarbild mit dem Konterfei ihres Sohnes zu gestalten.
Nachdem in Aluigis Abbild die Handlung kurz gehalten wird – ein Porträt wird bestellt und nie gemalt – verlagert sich der Fokus sofort auf die Sprache, in der der Briefverkehr höfischen Absenders verfasst ist. Alois Brandstetter gelingt es wunderbar, einen Sprachduktus anzunehmen, der die barocken Höflichkeitsfloskeln abbildet und – denn der Leser entstammt einer anderen Zeit – die Ironie der Schicksale der Protagonisten fein herausarbeitet.
Höfische Sprachmalerei
Gleichzeitig befremdet der überaus blumige Schreibstil, denn heutige Lesegewohnheiten sind anders und man mag bisweilen etwas ungeduldig die Seiten blättern. Was aber wunderbar dargestellt wird, ist die Doppelbödigkeit der barocken Moral. Mitten im Dreißigjährigen Krieg, zwischen Hexenverbrennungen und Pestepidemien, konversieren Dialogpartner, die sich keine Blöße geben wollen, die eine gefestigte Meinung vertreten, aber nicht darüber sprechen dürfen.
Bigotterie und Lebenslust
Wenn also Donna Marta ihrer Kammerzofe erklärt, wie heilig und unberührt ihr Sohn Aluigi doch war und die Kammerzofe vorsichtig ins Gespräch einflicht, dass der Grat zwischen Heiligem und Sonderling doch ein schmaler sei und im Verlauf deutlich wird, dass der Verzicht auf alle weltlichen Würden bei einem hochverschuldeten Adelshaus eher ein Gewinn denn Verlust ist, erhält die Figur des Aluigi nicht nur Risse, sie führt sich selbst ad absurdum.
Rubens dagegen muss sich vor Donna Marta für seine üppigen Frauengestalten verantworten, es wird ihm Unkeuschheit vorgeworfen. Er selbst kann dagegen nichts für den asketischen Lebensstil des Aluigi empfinden und schlägt kurzerhand vor, sein Meisterschüler van Dyck könne doch das Porträt übernehmen. Van Dyck, ein junges Genie im religiösen Kinderwahn, lässt sich auf den Handel nur zu gerne ein, doch die Reise nach Italien wird die Grand Tour des Künstlers, aus der er gereift hervorgeht – ohne das Porträt gemalt zu haben.
Stärkste Momente erst zum Schluss
Van Dyck wandelt sich vom ultrakonservativem Katholiken zum höfischen Maler, der Affären und uneheliche Kinder hat und den Glauben an die reine katholische Lehre spätestens in Rom verliert. Der Briefwechsel mit Donna Marta gestaltet sich entsprechend verhalten und über lange Strecken wirkt das Zaudern des van Dyck fast ennervierend, denn das Ende der Geschichte ist längst klar. Es scheint, dass Brandstetter Zeit schindet, die höfische Sprache verliert gegen Ende etwas an Schliff, oder ist es nur Langeweile, die sich breitmacht?
Den stärksten Moment hat der Autor in seinem Schlussplädoyer. Van Dyck wurde britischer Hofmaler, einer der wichtigsten Künstler Europas. Er verlor den Glauben und die Strenge, kurz, er wurde erwachsen. In einer Welt der jugendlichen Helden stellt Brandstetter sich die Frage, die niemand beantworten kann: Wie wäre Aluigi als alter Mann gewesen? Desillusioniert? Der Reiz der Revolution hängt an der Jugend, man weiß es längst. Ein alter Jesus? James Dean als Rentner? Che Guevara als Großvater? Unvorstellbar. Alternde Revolutionäre enden in der Bedeutungslosigkeit oder als Diktatoren. Der Glanz der Jugend vergeht.
Titelangaben:
Alois Brandstetter: Aluigis Abbild
Wien: Residenz Verlag 2015
192 Seiten. 19,90 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| mehr von Alois Brandstetter in TITEL kulturmagazin