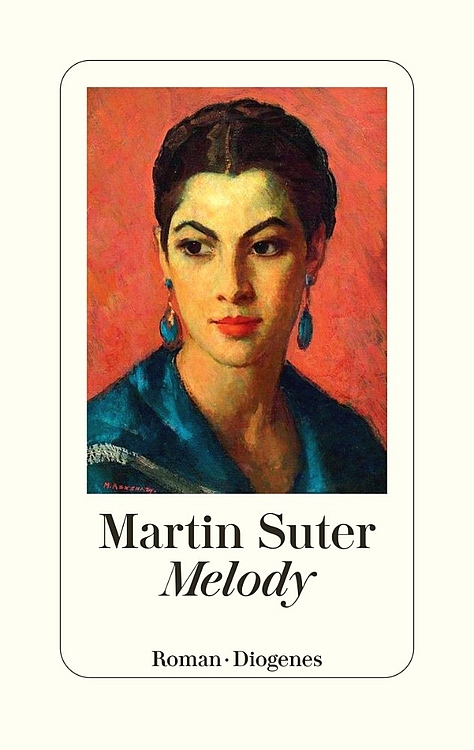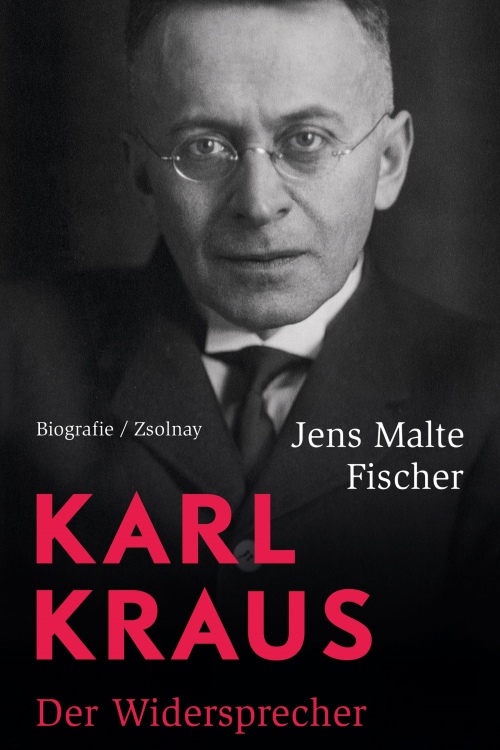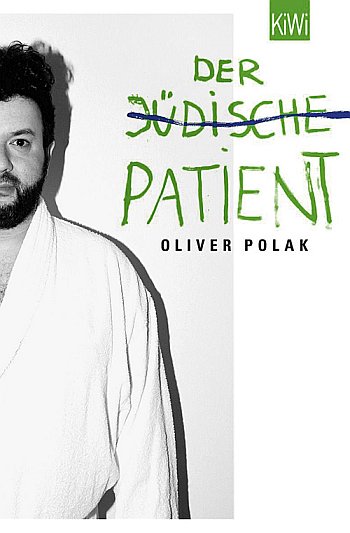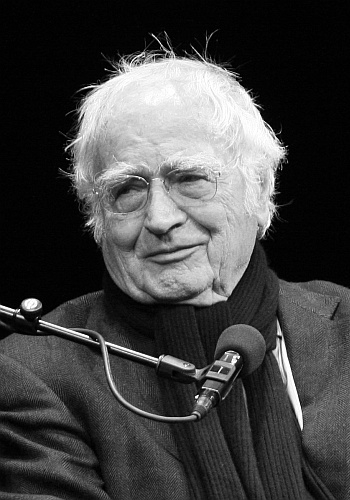Sie trug einen berühmten Namen und eine große Bürde. Monika Mann ist die Außenseiterin der legendären, faszinierenden Künstlerfamilie. Doch Sonderlinge sind spannend – in der Literatur wie im Leben, findet Kerstin Holzer, die ein zutiefst einfühlsames und bewegendes Porträt der Tochter von Thomas Mann geschrieben hat. Die Autorin begibt sich in ›Monascella – Monika Mann und ihr Leben auf Capri‹ auf die Spuren einer Frau, die auf der italienischen Insel ihre Selbstbefreiung und die Liebe erfuhr und zur Schriftstellerin reifte. Von DIETER KALTWASSER
 Sie reiste im Dezember 1954 nach Capri und lebte über dreißig Jahre auf der Mittelmeerinsel in der Villa Monacone. Was hielt das »arme Mönle«, wie sie innerhalb der »amazing family« des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann genannt wurde, auf dieser Insel? Die 1967 in Bonn geborene Journalistin Kerstin Holzer schrieb u.a. ein Lebensporträt Elisabeth Mann Borgeses, der jüngsten Tochter von Thomas und Katia Mann. Sie hat auf der Basis unveröffentlichter Quellen und Gesprächen mit Zeitzeugen eine Frau porträtiert, die einen schweren Stand in ihrer Familie hatte und erst auf Capri zu sich selbst fand. Ihr Buch schildert die „Geschichte eines glücklichen Neuanfangs in der Mitte des Lebens«, denn auf dieser Insel »fand Monika Mann ein Zuhause, die Liebe und ihre Stimme als Autorin. Sie versuchte auf der Mittelmeerinsel seelisch zu gesunden.«
Sie reiste im Dezember 1954 nach Capri und lebte über dreißig Jahre auf der Mittelmeerinsel in der Villa Monacone. Was hielt das »arme Mönle«, wie sie innerhalb der »amazing family« des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann genannt wurde, auf dieser Insel? Die 1967 in Bonn geborene Journalistin Kerstin Holzer schrieb u.a. ein Lebensporträt Elisabeth Mann Borgeses, der jüngsten Tochter von Thomas und Katia Mann. Sie hat auf der Basis unveröffentlichter Quellen und Gesprächen mit Zeitzeugen eine Frau porträtiert, die einen schweren Stand in ihrer Familie hatte und erst auf Capri zu sich selbst fand. Ihr Buch schildert die „Geschichte eines glücklichen Neuanfangs in der Mitte des Lebens«, denn auf dieser Insel »fand Monika Mann ein Zuhause, die Liebe und ihre Stimme als Autorin. Sie versuchte auf der Mittelmeerinsel seelisch zu gesunden.«
Über die Familie von Thomas Mann ist bereits viel geschrieben worden, über die ältesten Kinder Klaus und Erika, den Historiker Golo, über die Wissenschaftlerin Elisabeth und den Musiker Michael und dessen Sohn Frido. Monika hingegen galt als weniger begabt und untalentiert. Nachdem Elisabeth und Michael geboren waren, sei ihre Kindheit, sie war damals acht Jahre alt, zu Ende gewesen, heißt es in Kerstin Holzers Buch: »(…) man muss die Gabe haben, sich in Szene zu setzen, sonst wird man übergangen.«
Die Autorin fügt hinzu, dass es auch für die anderen Kinder im Hause Mann nicht einfach war. Als 1919 der jüngste Sohn Michael zur Welt kam, erregte »das Kleinkind mit dem Spitznamen ‚Bibi‘ bei Thomas Mann immer wieder ‚Fremdheit, Kälte, ja Abneigung‘. Elisabeth hingegen ist »Herr Papales« Erwählte, sie gilt als ausgeglichen und unkompliziert. Sie wird, eine »Ausnahme bei den Mann-Sprösslingen, sehr gut in der Schule sein.« Monika hingegen stand bereits als Kind im Schatten ihrer Geschwister. Als sie am 7. Juni 1910 geboren wird, gibt es bereits drei ältere Geschwister, das ‚Pärchen‘ Erika und Klaus sowie den Bruder Angelus, genannt Golo.
Ihre Eltern halten sie für unbegabt. Monika versucht sich in verschiedenen Künsten: Sie vertieft sich in die Musik, doch sie bricht ihren Klavierunterricht ab, sie besucht eine Kunstgewerbeschule in München und eine Kunstschule in Paris. Von einem Abschluss dort ist nichts bekannt. Monika kehrt zurück nach München zu ihren Eltern. Aber ihr Talent reichte nicht, befand man; sie blieb die Randfigur, für die Eltern war sie zeitlebens nur eine »künstlerische Oberflächenbegabung«. Ihre Mutter Katia kommentierte: »Mönle schrieb mir einen recht törichten Brief: Die Menschen hemmten sie so, weil sie so grausam seien, aber wenn sie das überwinde, werde sie bestimmt ‚irgendwie produktiv‘ werden. Das Kind flüchtet sich in prätentiöse Verstiegenheit und hätschelt seine heilige Trägheit.« Nur ihr Bruder Klaus und ihr Onkel Heinrich standen ihr näher.
1939 heiratet Monika Mann in London den ungarischen Kunsthistoriker Jenö Lányi. Wenig später die Tragödie: Das Schiff, mit dem sie nach Kanada fliehen wollen, wird von einem deutschen U-Boot torpediert. Jenö ertrinkt vor Monikas Augen. Sie trägt in ihr Tagebuch ein: »Ich hatte das untrügliche Empfinden, dass ich gerettet und geschlagen zugleich war – eine grausame Zerreißprobe.« Später wird sie in ihr New Yorker Tagebuch eintragen: »… man mag von den schlimmsten Schlägen getroffen werden, der Felsen der Existenz ist stets derselbe.« In den Jahren des Exils taumelte sie durchs Leben, das Trauma der Schiffskatastrophe belastete sie schwer und machte ihr Leben, das sie in den USA fortführte, nicht einfacher. Sie führt ein Emigrantenleben und wechselt aufgrund von Differenzen mit ihrer Familie häufig den Wohnsitz.
»Der Wind hat mich hergetragen« – mit diesen Worten beschreibt Monika Mann, wie sie im Winter 1954 nach Capri kam, und deutet damit an, das vieles in ihrem Leben dem Zufall überlassen blieb. Dennoch bedauerte sie es nie, mit »ihrem fahrenden Haus«, wie sie es nannte, umherzuziehen. Der in Rom lebende Maler und Schriftsteller Rolf Schott hatte ihr die Insel Capri empfohlen, »einen landschaftlich reizvollen Flecken, der könnte ihr gefallen.« Und in der Villa Monacone hatten schon Künstler wie Oskar Kokoschka residiert.
Italien ist der Sehnsuchtsort der Deutschen in den Fünfzigerjahren und Capri gilt als Künstlerrefugium, standesgemäß für eine Tochter Thomas Manns. Mit einer familiären Apanage ausgestattet, lässt sie sich mit 44 Jahren auf der Insel nieder, »das einladende, fast herrschaftliche Haus, die Säulen und Veranda, die ›riesige Aussicht‹ auf Meer und Felsen, sie spürt Ruhe und Weite.« Später wird sie es »Liebe auf den ersten Blick« nennen. Und diese schließt auch, schreibt Kerstin Holzer, Antonio Spadaro mit ein, dessen Familie die Villa gehört. Er ist drei Jahre älter als Monika und wohnt unter ihrem Apartment.
Sie verliebt sich in ihn und lebt über dreißig Jahre – bis zu seinem Tod – mit ihm in der Villa Monacone. Sein Vater, ein Fischer und Maurer, hatte sie erbaut. Antonio macht sie darauf aufmerksam, dass jene nach einem der vier berühmten Faraglioni-Felsen benannt ist, die vor Capri aus dem Meer ragen: Der Monacone-Felsen liegt buchstäblich im Schatten der drei anderen. Dass Monika Mann jetzt in der Villa Monacone wohnt, bestärkt sie darin, am rechten Ort angekommen zu sein. Hier reift sie zur Schriftstellerin, sie wagt sich wieder ans Schreiben. Auch ihre »Erinnerungen an Kindheit, Familie und Emigration will sie festhalten und ihre Lebenssicht neu ordnen.«
Ihr autobiographisches Buch ›Vergangenes und Gegenwärtiges‹ wird ein Erfolg. Die ersten Sätze des Werkes lauten: »Ich lebe auf einer Insel. Es ist still da, und die Menschen machen sich Gedanken.« Über das Leben, den »ewigen Kampf um das Gelingen«, die »Selbstbefreiung«. Ihr Glück endet mit dem Tod von Antonio Spadaro im Dezember 1985. Die Erben ließen Monika Mann sechs Monate, um die Villa zu räumen. Zunächst zieht sie nach Kilchberg, danach hat sie wechselnde Wohnsitze in Hotels und bei Freunden in Zürich. Im Winter 1986 besucht die Journalistin Helga Schalkhäuser sie in Zürich, wo sie vorübergehend bei einer Jugendfreundin untergekommen ist. Sie »wirkt teilnahmslos, wie erloschen.« Ihr Bruder Golo bringt sie Ende der 1980er Jahre nach Leverkusen zu Ingrid Beck-Mann, der Witwe seines Adoptivsohnes und ausgebildeten Krankenpflegerin. Sie lebe, heißt es, »die meiste Zeit in ihrer eigenen Welt.« Monika Mann stirbt am 17. März 1992 im Alter von 81 Jahren, von der Welt vergessen, in Leverkusen. Sie wird im Familiengrab in Kilchberg beigesetzt.
Titelangaben
Kerstin Holzer: Monascella – Monika Mann und ihr Leben auf Capri
München: dtv 2022
208 Seiten, 22 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander