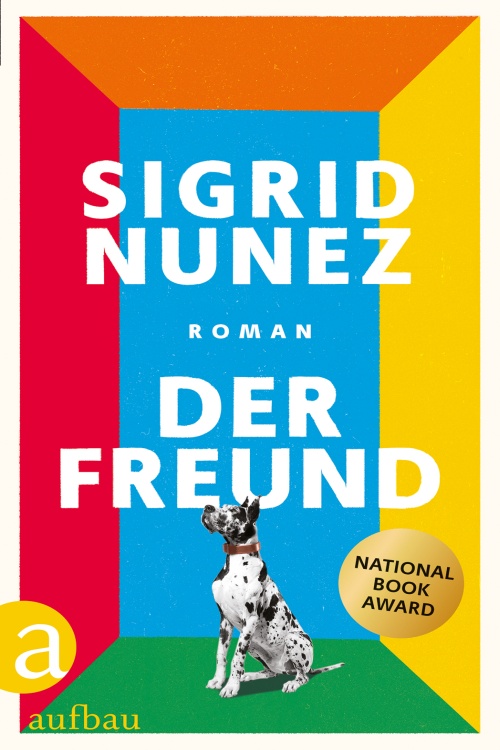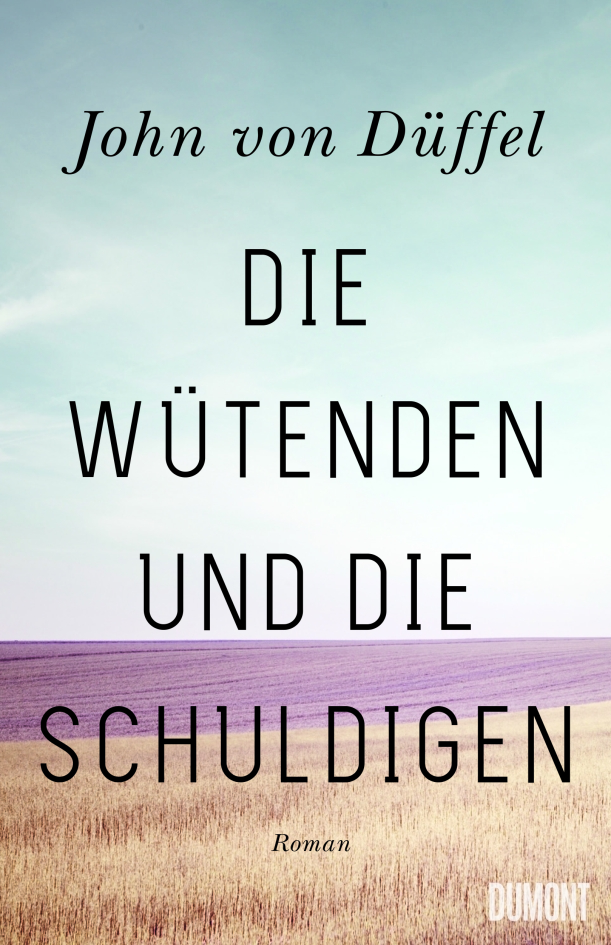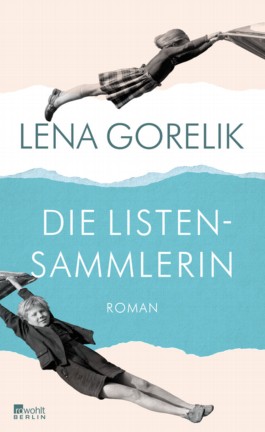Viel weiß man über Vincent van Gogh, jedoch wenig über seine Schwestern. Mit Hilfe eines Briefwechsels der Geschwister van Gogh veranschaulicht Willem Jan-Verlinden in Vincents Schwestern ihre gemeinsame Geschichte. Von BETTINA GUTIÈRREZ
 Mit einer bisher unveröffentlichten Korrespondenz zwischen Vincent van Gogh und seinen Schwestern befasst sich der niederländische Kunsthistoriker Willem Jan-Verlinden in Vincents Schwestern. Hier schildert er anhand eines regen Briefwechsels das Verhältnis des Malers zu seinen drei Schwestern Anna, Lies und Willemine und beleuchtet gleichzeitig den familiären Hintergrund der Familie van Gogh.
Mit einer bisher unveröffentlichten Korrespondenz zwischen Vincent van Gogh und seinen Schwestern befasst sich der niederländische Kunsthistoriker Willem Jan-Verlinden in Vincents Schwestern. Hier schildert er anhand eines regen Briefwechsels das Verhältnis des Malers zu seinen drei Schwestern Anna, Lies und Willemine und beleuchtet gleichzeitig den familiären Hintergrund der Familie van Gogh.
Die sechs Kinder, das heißt Vincent, seine Brüder Theo, Cent und drei Schwestern wachsen wohlbehütet in Holland auf. Der Vater Dorus ist ein protestantischer Pfarrer, ein Beruf, der in der damaligen Zeit auf dem zweithöchsten gesellschaftlichen Rang stand. Durchaus standesgemäß erziehen die Eltern Anna und Dorus daher ihre Kinder und lassen sie, ganz klassisch, in Musik, Kunst und Literatur unterrichten. Aber auch die Liebe zur Natur, Ehrfurcht vor Gott und eine gewisse Weltoffenheit spielen in ihrer Kindheit und Jugend eine wichtige Rolle.
So werden Anna und Lies auf ein französisches Internat geschickt, Theo zieht es schon früh nach Brüssel und Vincent nach London. Später gehen Anna und ihre Schwester Willemine nach England, wo sie eine Weile bleiben, bis sie wieder in ihre Heimat zurückkehren. Es ist eine Erziehung, die im Zeichen der gebildeten kosmopolitischen Tradition des gehobenen niederländischen Bürgertums steht und von einem innigen, harmonischen Familienleben geprägt ist.
»Die Kinder van Gogh wachsen in und rund um das Pfarrhaus in einer warmherzigen und beschützten Umgebung auf, doch als Vorbereitung auf die Härten des täglichen Lebens sind dies nicht die besten Voraussetzungen« erläutert Verlinden zu Beginn seines Buchs das familiäre Umfeld der Geschwister. Deshalb verwundert es auch nicht, dass sich ihre Lebenswege im Laufe der Zeit ganz anders als zu Hause vorgelebt und teils dramatisch entwickeln. Sachlich, freundlich und einfühlsam beschreibt er aufgrund der umfangreichen Korrespondenz ihre unterschiedlichen Werdegänge.
Lies und Willemine sind zwei selbständige Frauen, die sich schon in jungen Jahren freiwillig mit der eher unsanften Realität auseinandersetzen. Trotz ihrer künstlerischen Begabung begeben sie sich auf die Suche nach einer Anstellung, was damals für Frauen alles andere als einfach war. Sie arbeiten abwechselnd als Lehrerinnen, Gesellschaftsdamen und Gouvernanten, bis sie ein schweres Schicksal ereilt: Lies heiratet den Advokaten Philippe Du Quesne und gebärt ihm, neben einer unehelichen Tochter, drei Kinder. Doch wegen einer zunehmenden psychischen Erkrankung wird Philippe in eine Klinik eingewiesen, so dass sie alleine mit den Kindern und großen Geldsorgen zurückbleibt. Und auch Willemine, einst Lieblingsschwester von Vincent, ist aufgrund ihrer labilen Veranlagung psychisch erkrankt und verbringt ab dem Jahr 1902 ihr restliches Leben in einer Anstalt. Einzig und allein Anna ist Glück beschieden: Sie heiratet den Unternehmer Joan van Houten, gründet mit ihm eine Familie und führt fortan eine glückliche Ehe.
Die Beziehungen der drei Schwestern zu ihrem berühmten Bruder Vincent zeichnen sich allerdings als wechselhaft ab. Hatten sie zunächst ein herzliches Verhältnis zu ihm, besonders Willemine, kristallisieren sich im Laufe der Jahre zunehmend tiefe Zerwürfnisse heraus, die in Vincents schwieriger und introvertierter Künstlernatur und seinem Sonderweg begründet liegen. Als er 1878 zu seinem Bruder Theo, der in Paris als Kunsthändler arbeitet, zieht, hat er endgültig mit seinen Schwestern und Eltern gebrochen.
Das Leben von Vincent van Gogh und sein Ende, der Selbstmord, sind hinlänglich bekannt. Auch sein Bruder Theo, der ein halbes Jahr nach Vincents Tod stirbt, ist durch die Veröffentlichung der Briefe an seinen Bruder kein Unbekannter. Dass der jüngste Bruder Cor, der in Südafrika in Kriegsgefangenschaft geriet und dort erkrankte, sich ebenfalls das Leben nahm, erfährt man erst in Vincents Schwestern. So wie man hier auch zum ersten Mal Lies, Willemine und Anna begegnet, drei interessanten Persönlichkeiten in turbulenten Zeiten.
»Seine Eltern und seine Geschwister gaben Vincent noch etwas anderes mit: Liebe, Herkunft, familiäre Werte, Fürsorglichkeit für seine Mitmenschen, Liebe zur Natur, zur Kunst und Literatur, und mehr als alles andere, die Überzeugung dem Herzen folgen zu müssen« fasst Willem-Jan Verlinden die ethischen Werte der van Goghs am Ende seiner Ausführungen zusammen. Es sind positive zeitlose Werte einer beeindruckenden Familie, die man nun nach der Lektüre dieses besonderen Buchs nicht vergessen wird.
Titelangaben
Willem-Jan Verlinden: Vincents Schwestern
München: Elisabeth Sandmann Verlag 2023
304 Seiten, 32 Euro
| Erwerben Sie diesen Band portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe