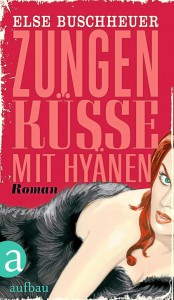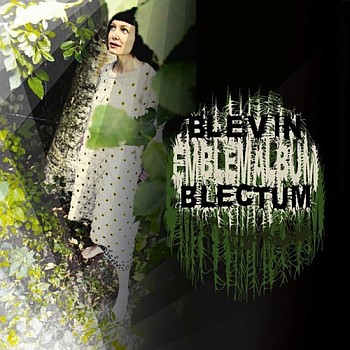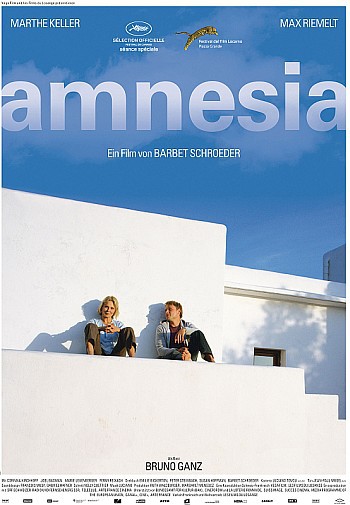Film | TV: TATORT – Türkischer Honig (MDR), 1.1.
Die ersten Minuten reißen uns ratzfatz in Abgründe, uns bleibt kaum eine Sekunde, uns über das übernächtigte Gesicht der Eva Saalfeld zu wundern, wir werden in familiäre Verstrickungen geworfen, »Ich bin dein Vater!«, »Du bist Abschaum!«. Nein, »Action« sollte das niemand nennen.
Von WOLF SENFF

Verwandtschaft auf Null, aber …
Julia Bahrig (Josephine Preuß) ruft ihre Schwester Eva Saalfeld (Simone Thomalla) an, sie müsse sie unbedingt treffen. Die beiden haben sich jahrelang nicht gesehen, die Verwandtschaftsverhältnisse waren auf Null geschraubt, die Mutter betreibt eine Schneiderei auf Zypern, der Vater Horst Saalfeld (Günther Junghans) – man erinnert sich – ist inhaftiert.
Julia, die eben noch ihr kleines Geschäft abschließt, in dem sie Türkischen Honig aus eigener Produktion verkauft, und über die Straße geht, wird urplötzlich in ein Auto gezerrt und ist entführt, bevor Eva Saalfeld, die auf der anderen Straßenseite wartet, überhaupt reagieren kann.
Von heimischen und moslemischen Bräuchen
Die mitreißenden Ereignisse entführen in heimische und moslemische Bräuche. Das Tempo bleibt rasant, allein mit dem Auftreten Andreas Kepplers (Martin Wuttke) kommt es augenblicklich zur Ruhe; seine souveränes, latent selbstironisches Auftreten bremst jegliche Hektik aus, sein spontanes Interesse für den Ford Mustang von Ersoy Günes (Dennis Moschitto) überbrückt im Nu jegliche kulturelle Differenz. So läuft es halt mit Männern, was kann man tun.
Türkischer Honig ist auf menschliches Niveau herunter gedimmt, ein dramatischer Krimi ohne alarmistische Auftritte. Die Probleme von Eva Saalfeld sind in Ersoys Familie kontrastreich abgebildet. »Ich wette, als du sechzehn warst«, Keppler zu Ersoy, »da hast du heimlich was getrunken. Und er hat dich erwischt. Er hat dich windelweich geschlagen, mit nem Stuhlbein oder so. Und seitdem hast du keinen Tropfen mehr angerührt.«
Ein Gespräch, das Vertrauen schafft. »Es gibt da etwas, was Sie tun könnten. Ich möchte meinen Vater waschen dürfen. Das wär‘ ihm wichtig gewesen.« Und schon sitzen sie wie zwei Gockel in Ersoys Mustang Roadster, überholen noch kurz die Kollegin in ihrer biederen mitteleuropäischen Serienkarosse, und Keppler kutschiert zum Imam. Ersoy ist unsterblich verliebt, und das führte zu einem Problem mit dem Vater.
Leipziger Privilegien
Türkischer Honig lässt dadurch, dass Spannungen in den Familien die Beteiligten hier wie dort nur ratlos und verzweifelt machen, gar nicht erst zu, dass politische Klischees und hohle Bekenntnisse aufkommen. Ersoy Günes erweist sich als ein vernünftiger junger Mann.
Auf den Leipziger TATORT ist, wie’s scheint, Verlass. Gewiss aufgrund der hervorragenden Besetzung, aber auch weil er darauf verzichtet, die Saalfeld-Keppler-Grundierung, wie es so schön heißt, zu »entwickeln« – die Kommissare dürfen bleiben, wie sie sind. Das ist doch mal ein Privileg.
| WOLF SENFF
Titelangaben
TATORT: Türkischer Honig (MDR)
Regie: Christine Hartmann
Ermittler: Martin Wuttke, Simone Thomalla
Mi., 1.1., ARD, 20:15 Uhr
Reinschauen
Alle Sendetermine und Online-Abruf auf DasErste.de
Gregor Keuschnig zu Rüdiger Dingemann: »Tatort«-Lexikon
Rüdiger Dingemann: »Tatort«-Lexikon (eBook)