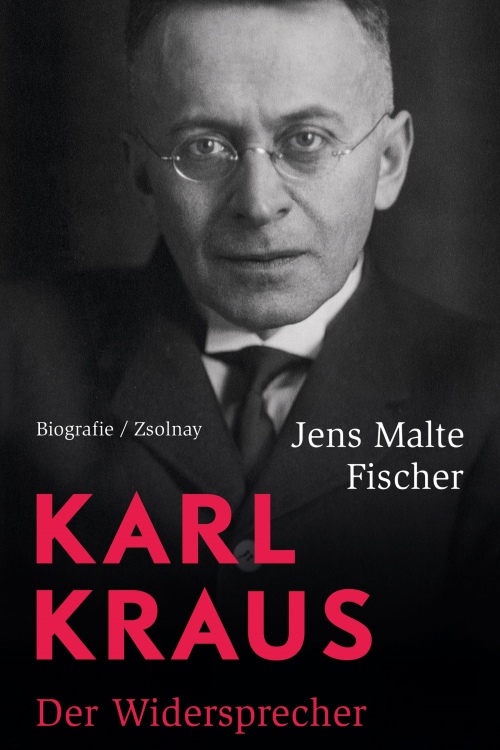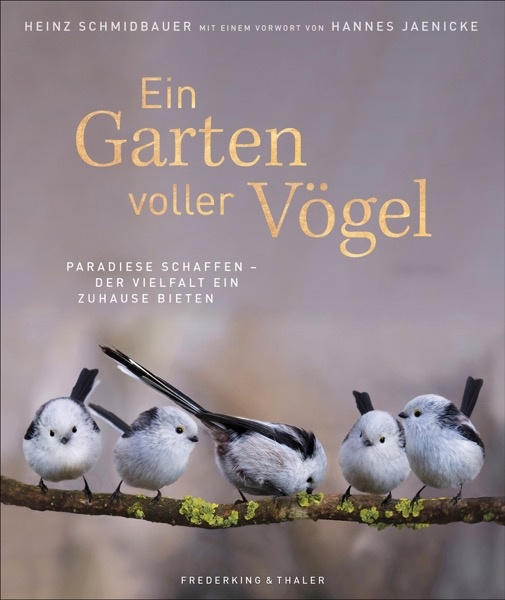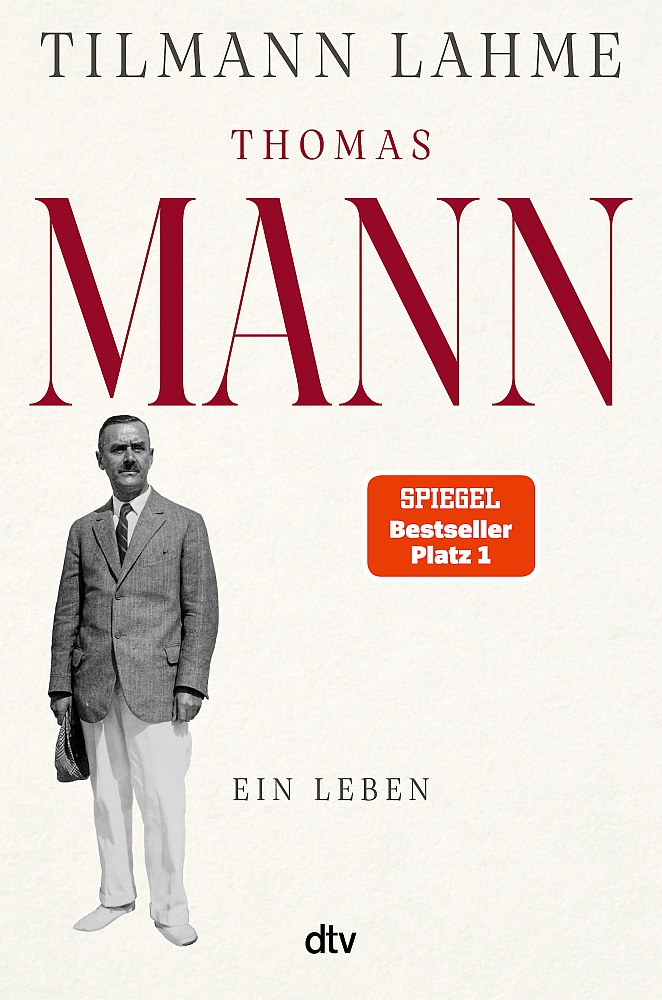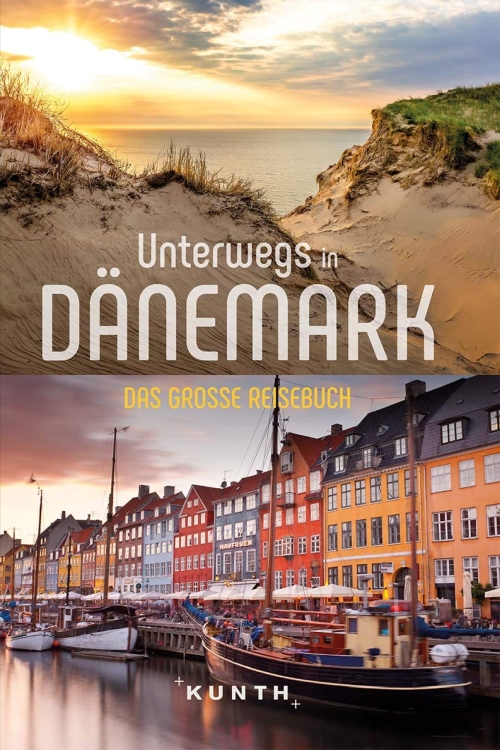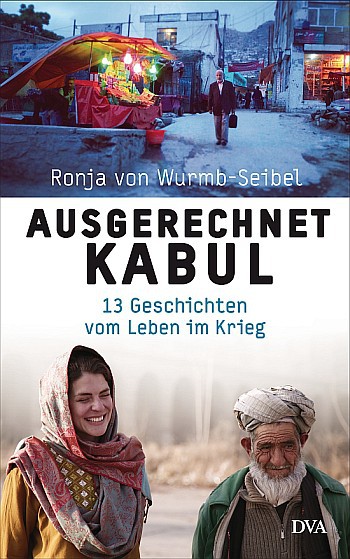Alfred Döblin in Baden-Baden und Maxim Gorki in St. Blasien. Ein neues Buch gibt Auskunft über Dichter und Politik im deutschen Südwesten, von Schubart und Hölderlin bis Hochhuth und Jünger. Von GEORG PATZER
 Lange hat er Albträume gehabt: »Ich bin durch einen Zauber auf diesen Boden versetzt, ich sehe Nazis, sie kommen auf mich zu, fragen mich aus.« Als der Dichter Alfred Döblin am 9. November 1945 nach 12 Jahren Exil in Baden-Baden eintrifft, in dieser »leblosen Mittelstadt«, scheinen sie wahr zu werden: »Ich fahre zusammen: Man spricht neben mir Deutsch!«
Lange hat er Albträume gehabt: »Ich bin durch einen Zauber auf diesen Boden versetzt, ich sehe Nazis, sie kommen auf mich zu, fragen mich aus.« Als der Dichter Alfred Döblin am 9. November 1945 nach 12 Jahren Exil in Baden-Baden eintrifft, in dieser »leblosen Mittelstadt«, scheinen sie wahr zu werden: »Ich fahre zusammen: Man spricht neben mir Deutsch!«
Er kommt zurück als ziviler Angehöriger der französischen Besatzungsbehörden und will sich am kulturellen und demokratischen Wiederaufbau Deutschlands beteiligen. Dazu gehört auch, dass die Deutschen sich ihren Verbrechen stellen. Was aber erlebt Döblin in Baden-Baden? Keine Spur von Schuld oder Aufarbeitung: »Die Menschen sind dieselben, die ich 1933 verließ. Neu ist mir eine gewisse geistige Schwerfälligkeit. Sie sind verstört, gequält und wollen zufriedengelassen sein.«
Sein Kampf dagegen ist mühsam: »Wen auch immer ich sprach: Er wusste nichts, er wusste von nichts, er leugnete, bemäntelte und verschwieg. Vor diesen Leuten über Demokratie zu reden, war schwierig.« Döblin tut es trotzdem: Er organisiert im Theater »Réunionen« und gründet den Verband südwestdeutscher Autoren und den Kulturrat der Stadt, aber es bleibt ihm alles zu provinziell. Mit Otto Flake freundet er sich an, gibt die Zeitung ›Das goldene Tor‹ heraus und hat eine Sendung im Südwestfunk.
Dichter des Südwestens und die Politik, das ist ein weites Feld. Da ist Hölderlin, der beim Rastatter Kongress anwesend ist, der über das Schicksal Badens und Württembergs nach den Napoleonischen Kriegen entscheiden sollte, der politische Mord am konservativen Dramatiker August von Kotzebue in Mannheim, die Warnungen von Joseph Victor von Scheffel vor den Radikalen der Revolution von 1848, die Kuraufenthalte von Anton Tschechow in Badenweiler und Maxim Gorki in St. Blasien. Lenin hatte seinem Freund Gorki die dortige Heilanstalt empfohlen: Dort könne man »Lungenaffektionen vollständig heilen, indem man die Patienten aufpäppelt und sie systematisch an die Kälte gewöhnt; so härtet man sie ab und kann sie kräftig und arbeitsfähig entlassen.«
Ein neuer, voluminöser und spottbilliger Sammelband (6,50 Euro!) vereinigt jetzt 39 kurze, prägnant und oft lebendig geschriebene Aufsätze über die Dichter, die unter der Politik litten wie der viele Jahre auf dem Hohenasperg inhaftierte Schubart oder Paul Celan in Tübingen oder sich einmischten wie Rolf Hochhuth in Brombach. Es gibt Berichte von Pazifisten wie René Schickele in Badenweiler und Juden wie Jacob Picard in Überlingen.
Der Band bietet kurze Einblicke in die bunte Vielfalt zwischen direktem Engagement und distanzierterer Beobachtung und Analyse. Dadurch ergeben sich immer wieder charakteristische Momentaufnahmen, die die Politik, die Zeitumstände und den Dichter (nur drei Frauen sind darunter) treffend beschreiben.
Es ist ein Sammelband, der Lust auf mehr macht, vielleicht auf die schöne Reihe ›Spuren‹ aus dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach – Thomas Schmidt ist auch ihr Herausgeber, u.a. gibt es Hefte über Günter Eich und Georg Groddeck in Baden-Baden oder Rainer M. Gerhardt in Karlsruhe.
Titelangaben
Thomas Schmidt und Kristina Mateescu (Hrsg.): Von Hölderlin bis Jünger
Zur politischen Topographie der Literatur im deutschen Südwesten
Schriften zur politischen Landeskunde Baden-Württembergs, Band 51
Stuttgart: Landeszentrale für politische Bildung BW 2019
449 Seiten, 6,50 Euro